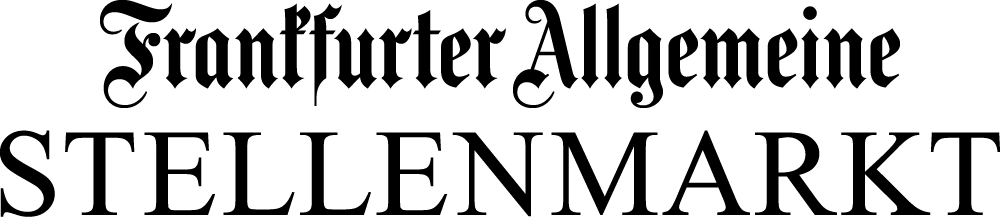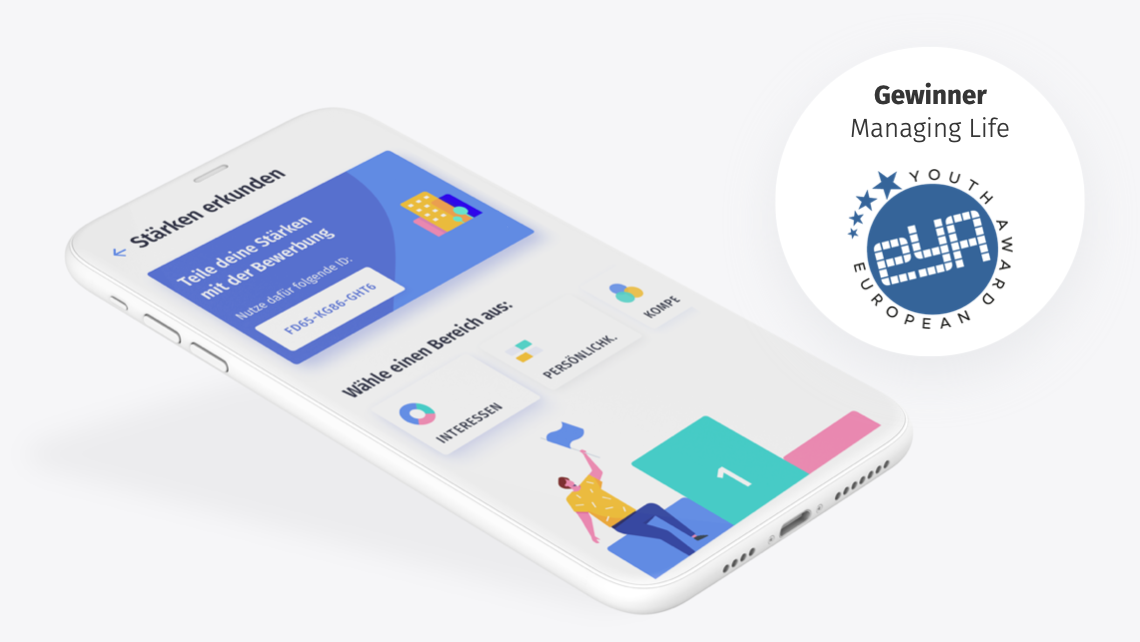Reist du noch, oder arbeitest du schon?

Eat. Pray. Love. Work. Digitale Nomaden ziehen gerne nach Bali. Das liegt nicht nur am guten Netz und den angenehmen Außentemperaturen.
Marion Kutta blickt von ihrem Laptop auf. Anstatt auf die Münchner Innenstadt, wo sich bis vor kurzem ihr Büro befand, schaut sie auf ein üppig grünes Reisfeld. Über ihrem Kopf rührt ein Ventilator die heiße Luft um. An der Wand hängt der „Bali Advertiser“, das Anzeigenblatt für all jene Westler, die auf der indonesische Ferieninsel leben. Während die Surfer an der Küste bleiben, zieht es die digitalen Nomaden nach Ubud, das künstlerische Zentrum Balis.
Die 57-Jährige hatte eine leitende Position in der Werbebranche, ehe sie sich vor zwölf Jahren mit ihrer Firma „Global Players“ selbständig machte. Seither berät sie Regisseure und Werbefilmproduzenten, hat sich dabei auf das Thema Nachhaltigkeit spezialisiert. „Ich kann meinen Job von jedem Ort der Welt aus machen“, sagt sie. Solange sie eine schnelle Datenleitung hat, und die gibt es hier im „Hubud“. „Hubud“ ist eine Wortkreation aus „Hub“ (Englisch für Drehkreuz) und „Ubud“. An der geschäftigen Monkey Forest Road im Zentrum des Städtchens gelegen, ist der sogenannte Co-Working-Space eine Art Großraumbüro, in das sich jeder einmieten kann. Es war das erste Projekt dieser Art auf Bali. Inzwischen gibt es mehrere Nachahmer.
Für 250 US-Dollar im Monat bekommt man hier einen Internetzugang und einen mobilen Arbeitsplatz, Skype-Kabinen und klimatisierte Sitzungsräume. Hubud hat einen eigenen Glasfaseranschluss, zwei Kabel, je 50 Megabit pro Sekunde, von verschiedenen Anbietern – falls eine Verbindung mal ausfallen sollte. Etwa 200 aktive Mitglieder, die aber nicht alle ständig vor Ort sind, nutzen die Leitung. Hier wird richtig konzentriert gearbeitet, gesprochen nur im Flüsterton.
Ein „Soft Landing“-Paket für 1400 Dollar mit SIM-Karte, Mietmotorroller und verschiedenen Wohnungen zur Auswahl hat Kutta das Einleben erleichtert. „Ich lerne viel von den jungen Social-Media-Freaks“, erzählt sie. „Und die wollen nicht einmal Geld. Ich biete ihnen dafür Rat und Erfahrung an. Gegenseitiges Helfen wird großgeschrieben. In München müsste ich solche Beraterleistungen teuer bezahlen.“ Die Infrastruktur auf Bali sei „unschlagbar“, sagt sie: preisgünstig, kaum Kriminalität, kurze Wege – ins Netz, zum Strand, an die Kaffeebar, deren Barista den Pumpendruck genauso präzise einstellt wie sein Kollege in München. Außerdem schätzt sie natürlich, was allen Touristen an Bali gefällt: die sanfte Art der Bewohner, ihre Nachsicht mit den westlichen Besuchern und deren mitunter ausgefallenen Wünschen, die hinduistischen Tempel mit den täglich stattfindenden Opferritualen, die tropische Landschaft, die frischen Früchte, die exotischen Gewürze, die gleichmäßigen Wellen des nahen Ozeans, wie gemacht für Surfer. All das, was schon frühen europäischen Aussteigern wie dem Deutschen Walter Spies und dem Niederländer Rudolf Bonnet gefiel. Die beiden gründeten in Ubud bereits 1936 eine Kunstschule. Schon damals pilgerten Westler auf die „sanfte Seele Asiens“ genannte Insel.
Heute drängt sich in Ubud Galerie an Galerie. Seit dort 2010 der Hollywood-Film „Eat. Pray. Love.“ gedreht wurde, in dem Julia Roberts eine Frau auf dem Selbstfindungstrip spielt, ist der 30 000-Einwohner-Ort bei Touristen noch beliebter geworden. Und nun haben auch die globalen Nomaden hier ihr Paradies gefunden: Blogger, Grafikdesigner und Programmierer nennen die Stadt längst „Silicon Bali“ oder das „Berkeley Asiens“.
Kutta ist mit einem Touristenvisum für 30 Tage ins Land gekommen, das sie um weitere 30 Tage verlängern lassen kann. Weil sie aber drei Monate bleiben will, muss sie einmal kurz ausreisen, wahrscheinlich nach Singapur. Daran erinnert sie Hubud-Chef Chris Thompson, der sich jetzt zu uns setzt und die Deutsche wie eine langjährige Freundin begrüßt. Einmal hätten die Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde bei Hubud schon vorbeigeschaut, erzählt er. Sie wollten wissen, was die Menschen hinter den Laptops eigentlich so treiben. „E-Mails schreiben und Videos auf Youtube schauen“, behauptete Thompson, woraufhin die Beamten wieder abzogen. Ob Indonesiens Regierung die globalen Nomaden auf alle Zeiten wie Touristen behandeln wird, ist derzeit schwer zu sagen.
Tatsächlich wissen die Regierungen vieler Länder nicht, wie sie mit dem relativ neuen Phänomen umgehen sollen. Wo sollen sich die digitalen Hippies, die von Land zu Land, von einem Co-Working Space zur nächsten ziehen, registrieren lassen? Wo Steuern zahlen? Bislang bietet nur Estland seit 2014 eine digitale Staatsbürgerschaft an, „E-Residency“ genannt. Sie erlaubt es modernen Nomaden, einen Steuerwohnsitz anzumelden, ein Konto zu eröffnen und eine Firma zu gründen. Die Idee dazu hatte der estländische Politiker Taavi Kotka, Mitgründer des Internettelefonanbieters Skype.
Hubud-Chef Thompson findet, dass die nationalen Regierungen hier viel kreativer sein müssten. Denn der Trend zum Nomadentum beschleunige sich derzeit rasant. Der Kalifornier ist selbst ein digitaler Nomade, hat in Städten rund um den Globus gearbeitet. 2010 kam er mit seiner Familie nach Bali, wollte drei Jahre bleiben. Inzwischen sind daraus bereits sechs geworden. Seine Kinder gehen auf die Green School, eine Art nachhaltig-ökologische Waldorfschule, nur wenige Kilometer von Ubud entfernt, die in Bildungsmedien weltweit als Schulmodell der Zukunft gepriesen wird. Chris war deren Leiter, als er mit den drei aus Kanada stammenden Gründerfamilien von Hubud Bekanntschaft machte, deren Kinder ebenfalls die „grüne“ Schule besuchten. Steve Munroe, einer der Gründer, lebt noch immer auf Bali. Ein anderer, Peter Wall, pendelt zwischen Indonesien und seiner früheren Heimat Kanada – wobei „Heimat“ für ihn und seine Mitstreiter ein zunehmend diffuser Begriff zu sein scheint.
Thompson schätzt, dass es derzeit einige Tausend Co-Working-Spaces weltweit gibt. Dem Wirtschaftsmagazin „Capital“ zufolge waren es 2015 etwa 2500, doch diese Zahl ist wohl längst überholt. Der bekannteste Anbieter ist WeWork, 2010 in New York City gegründet. Ende 2015 hatte WeWork nur 54 Standorte, jetzt sind es bereits 120 rund um den Erdball. Ubud-Chef Thompson glaubt, dass es bis 2020 rund 20 000 Spaces geben wird, bevölkert von zig Millionen Nomaden. Epizentren der Bewegung sind Buenos Aires, die nordthailändische Stadt Chiang Mai, aber auch Berlin, wo mit dem Betahaus bereits 2009 eine Space entstanden ist. Berlin und Bali haben durchaus etwas gemeinsam: Es sind beides noch erschwingliche Orte mit einem lässigen Image.
Neben Kutta haben zahlreiche andere Deutsche den Weg ins Hubud gefunden. Der Regensburger Fabian Zimmermann zum Beispiel hat von Indonesien aus einen Ersatzteilhandel für Luxusautos aufgebaut. Er verschickt die Teile via Online-Shop in die ganze Welt – ob er das von Bali oder von der Oberpfalz aus organisiere, spiele keine Rolle. Wer mit den neuen Nomaden spricht, merkt schnell: Sie kommen oft aus privilegierten Verhältnissen – Kinder von sogenannten ExPats, die für globale Konzerne ins Ausland entsandt wurden, Diplomatenkinder, die internationale Schulen besucht haben und sich in verschiedensten Kulturkreisen zu Hause fühlen. Soziologen nennen sie „Third Culture Kids“.
Chris Thompson, der perfekt in dieses Raster passt, weiß natürlich um die Herausforderungen, die damit einhergehen. Welchem Staat sind die digitalen Herumtreiber gegenüber loyal? Wer soll noch Kommunalpolitik gestalten, wenn es alle nur wenige Jahre an einem Ort hält? Welchen Nutzen haben die Spaces für die lokale Bevölkerung? Thompson räumt ein, dass die vielen Westler in Ubud die Mieten und das allgemeine Preisniveau steigen lassen. Für Einheimische werde es schwieriger, hier zu leben. Deshalb wolle er etwas an die Bevölkerung zurückgeben. „Das läuft aber nicht über Spenden oder populistische Müllsammelaktionen am Strand“, erklärt er. „Vielmehr bieten Hubud-Nutzer lokalen Firmen zum Beispiel kostenlos an, ihre Websites zu programmieren. Das finde ich viel nachhaltiger.“
Wie lange Marion Kutta in Bali bleibt, wird sich zeigen. Sie ist nicht blind. Sie sieht auch die Nachteile des globalen Nomadentums: das Einsickern der westlichen Einheitskultur mit Pizza und Burgern, die länger werdenden Verkehrsstaus in Ubud. Dennoch reizt die Chance, den Büroalltag westlicher Großstädte gegen ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten in einem Ferienparadies einzutauschen, offenbar immer mehr Menschen. Aber Kutta ist lange genug selbständig, um zu wissen, dass man als Ich-AG auch eine ganze Menge zu tun hat, unabhängig davon, ob man in Ubud oder München wohnt. Sie selbst ist braungebrannt und gönnt sich Auszeiten für Ausflüge und Strandbesuche. Aber sie wundert sich schon ein bisschen über ihre teilweise sehr blassen Kollegen.
GÜNTER KAST
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de