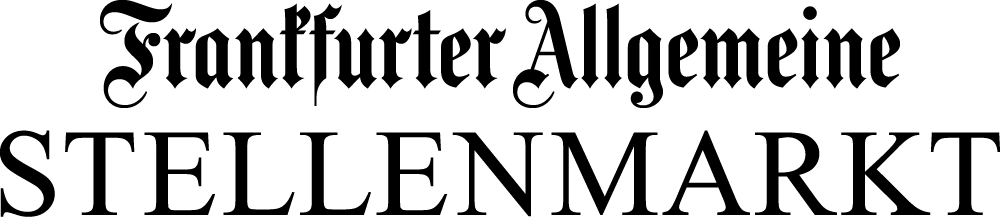Studiert bloß nicht Medizin: Gründe gegen ein Medizinstudium
Die Ergebnisse einer Umfrage unter Jungärzten schrecken auf. Der Traumberuf wird zum Knochenjob. Die Arbeit in der Klinik frustriert viele. Warum?
Die Desillusionierung kam schneller als erwartet. Dabei waren sie voller Enthusiasmus und Elan, als sie nach der Schule ihr Medizinstudium begannen. Fünf Jahre Texte büffeln, Formeln auswendig lernen und sich auf Multiple-Choice-Tests vorbereiten, waren auch kein Zuckerschlecken. Versagensängste und Tränen vor dem Physikum gehörten ebenso dazu wie beglückende Erfahrungen während der Famulatur in der Hausarztpraxis. Okay, im Praktischen Jahr, als sie erstmals im eigenen weißen Kittel den anderen auf Station folgen durften, da war der Druck auf dem Team oft schon greifbar gewesen. Aber so?
„Manchmal habe ich das Gefühl, ich betreibe reine Schadensbegrenzung, anstatt Patienten wirklich zu behandeln.“ Der Traumberuf Arzt wird für manche schon bald kurz nach dem Start zum Albtraum. „Es bleibt keine Zeit für eine patientengerechte Behandlung, vertrauensbildende Patienten- und Angehörigengespräche sind eher eine Last.“ Keine Zeit, zu wenig Zuwendung, aber zu viel Zorn. „Morgendlicher Appell in der Frühbesprechung, mehr Leute aufzunehmen oder zu entlassen, je nach Bettensituation.“ Noch ein Zitat einer jungen Assistenzärztin gefällig? „Ich betreue als Anfängerin bis zu 21 schwerstkranke Patienten am Tag, viele von ihnen präfinal. Ich werde oft aufgefordert, mit Angehörigen nur im Vorbeigehen auf dem Gang zu reden.“ Da sind Überlegungen wie diese nicht weit: „Man überlegt sich manchmal, ob man den Arztberuf jemandem anderen noch empfehlen kann, zumindest in der Klinik.“ Andere haben diese Phase schon hinter sich: „Man kann eigentlich nur allen Abiturienten raten, nie Medizin zu studieren.“
Welche Enttäuschungen, was für Abgründe tun sich für die Berufsanfänger auf. Manche sind mit dem Beruf durch, bevor es richtig losgeht mit Weiterbildung zum Facharzt, Karriere im Krankenhaus oder der Niederlassung – als angestellter Arzt oder als Herr in der eigenen Praxis. Die Zitate stammen aus einer neuen Befragung des Ärzteverbands Hartmannbund unter jungen Assistenzärzten am Krankenhaus. Zwei Drittel der 1331 Teilnehmer waren jünger als 33 Jahre, und fast ebenso viele haben erst seit zwei Jahren die Zulassung. Die Mehrzahl der Teilnehmer waren Frauen – ein Spiegelbild der Änderungen in der Geschlechterverteilung, die seit einigen Jahren in der Medizin zu beobachten ist – allerdings auf der Chefarztebene noch lange nicht angekommen ist.
Der Verband wollte wissen, was seine jungen Mitglieder umtreibt. Nun ist es nicht so, als wäre Klaus Reinhardt nicht bewusst, dass die Lage junger Ärzte manchmal angespannt und das Arbeitsumfeld anstrengend ist. Zwar ist es schon 25 Jahre her, dass der heutige Vorsitzende des Hartmannbundes selbst ein aufstrebender Assistenzarzt war. Nicht zuletzt seine berufspolitischen Aktivitäten haben den niedergelassenen Allgemeinmediziner aus Bielefeld mit dem Nachwuchs Kontakt halten lassen. Dennoch haben ihn die Ergebnisse der Befragung erschüttert. Reinhardt hält die Umfrageergebnisse in ihrer Deutlichkeit für „in Teilen erschreckend“ und hört daraus einen Hilferuf der jungen Ärztegeneration, so nicht mehr arbeiten zu wollen. „So kann es definitiv nicht weiter gehen“, sagt der 56-Jährige.
Er meint nicht allein die Desillusionierung der Berufseinsteiger in der Konfrontation mit der Wirklichkeit des Krankenhausbetriebs, der eben oft mehr Wirtschaftsbetrieb ist, als es jungen und alten Ärzten lieb ist. „Die Ökonomisierung des Medizinbetriebes hat inzwischen eine Dimension erreicht, die die Rolle des Arztes massiv verändert“, sagt Reinhardt. „Das klassische ärztliche Handeln, das den Patienten in den Mittelpunkt stellt, steht damit komplett zur Disposition.“
Umfrageergebnisse und schriftliche Kommentare der Teilnehmer dokumentierten überdeutlich, „dass viele junge Ärzte unter den aktuellen Arbeitsbedingungen an den Kliniken erheblich leiden“, ergänzt Theodor Uden. Der Blondschopf und Bartträger von 26 Jahren ist Sprecher der Assistenzärzte im Hartmannbund. Er absolviert derzeit das zweite Jahr der Weiterbildung an der Medizinischen Hochschule Hannover und will Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin werden.
Seinen Kollegen an den bundesdeutschen Krankenhäusern macht längst nicht allein die Arzt-Patienten-Beziehung Sorgen. Es sind auch die eigenen Arbeitsbedingungen, die den jungen Medizinern die Arbeit verleiden. Zwar beschreiben zwei Drittel der Befragten ihre Arbeitsbedingungen als „gut“ oder zumindest „befriedigend“. Auch Kommentare wie jene aus einem Bundeswehrkrankenhaus finden sich wieder: „Bei der Behandlung wird mehr Wert auf sichere Anwendung und Patientenkomfort gelegt als auf ökonomische Gesichtspunkte.“ Doch dabei handelt es sich um Ausnahmen, die Wirklichkeit ist rumpeliger. Die Detailbetrachtung gibt den Blick frei auf zahlreiche Schlaglöcher. Knapp die Hälfte der Teilnehmer gibt an, schon einmal aufgefordert worden zu sein, Überstunden nicht zu dokumentieren. Bei einem Fünftel erkennt die Krankenhausleitung demnach Überstunden erst gar nicht an. Mehr als jeder Zweite (54 Prozent) kann Pausenzeiten „selten“ oder „nie“ einhalten; zwei Drittel sagen, ihre Arbeitszeiterfassung sei nicht vor Manipulationen geschützt. Die übergroße Mehrheit (64 Prozent) hält die Personaldecke für unzureichend. „Mehr Personal“, fordert jemand, „ich habe nichts von mehr Gehalt, wenn ich keine Zeit für meine Familie und mein Kind habe.“
Genervt sind die davon, dass sie so viel Zeit für Schreibkram aufwenden müssen statt am Patienten zubringen können. Je ein Drittel der Jungärzte gibt an, „mehr als zwei“ oder „mehr als drei Stunden“ am Tag mit Dokumentation beschäftigt zu sein. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine umfangreiche Digitalisierung der Abläufe und auch eine Entlastung bei nicht ärztlichen Tätigkeiten die Patientenversorgung verbessern“, sucht Assistenzärztesprecher Uden dem Thema eine positive Wendung zu geben.
Doch die technische Ausstattung vieler Kliniken lässt zu wünschen übrig. Nur jede sechste kommt bei ihrem Informationssystem laut Befragung ohne Papier aus. Dagegen gehört es zum Alltag in Kliniken, dass Ärzte ihr privates Smartphone für dienstliche Zwecke wie Arzneimittel-Apps, Kalkulationen oder zum Nachschlagen von Fachfragen nutzen. Eher positiv fallen indes die Beurteilungen über die Chefs in der Weiterbildung aus. 58 Prozent der Assistenzärzte bewerten ihre Betreuung als „gut“ oder „sehr gut“, auch wenn sich die Hälfte über eine nur „ausreichende“ wenn nicht gar „mangelhafte“ Einarbeitung beklagt. Zwei von drei Assistenzärzten geben an, dass ihr Privatleben unter der Arbeitsbelastung leide. Einer schreibt: „Man hat nie richtig frei, außer man ist verreist.“ Drei von vier sagen, schon einmal auf Station erschienen zu sein, obwohl sie „eigentlich krankheitsbedingt unfähig waren zu arbeiten“.
In den Fragebögen haben sich manche ihren Frust von der Seele getextet: „Drei Wochenenden hintereinander arbeiten macht keinen Spaß“, lautet einer. Ein anderer: „Keinem Assistenzarzt in der Abteilung werden Überstunden genehmigt.“ Ein Dritter: „Ein Fluglotse darf aufgrund seiner Verantwortung nicht länger als sechs Stunden am Stück arbeiten, wir 24 Stunden. Wo bleibt da die Logik?“
Der betriebswirtschaftlichen Logik wird indes schneller gefolgt: „Unser Chef gibt regelmäßig die Zahlen der Verwaltung an uns weiter, unter anderem mit Kommentaren wie: ,Wir erwirtschaften weniger, aber machen mehr Überstunden. Das kann nicht sein.'“ Ein anderer merkt an, Mitarbeiter des Rechnungswesens „begleiten teilweise die Visiten und vermerken in Kurven, ab wann der Patient Geld kostet, anstatt welches einzubringen“. Wissend, dass das Wünschen nicht immer hilft, schreibt eine junge Ärztin: „Ich möchte mir als Stationsärztin keine Gedanken um Wirtschaftlichkeit und Gewinnspannen machen müssen.“
Wer mit viel Idealismus Arzt geworden ist, der müsse sich häufig erst damit abfinden, dass ein Krankenhaus vor allem auch ein Wirtschaftsbetrieb ist, sagt Assistenzarzt Uden vom Hartmannbund. Das in Einklang mit der täglichen Arbeit am Patienten zu bringen sei „für uns junge Ärzte eine echte Herausforderung“.
Von Andreas Mihm
Wenn sie mehr über das Medizinstudium und das Berufsfeld Medizin erfahren wollen, sollten Sie sich die passende Folge zu diesem Thema im F.A.Z.-Podcast „Beruf & Chance“ anhören.
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de