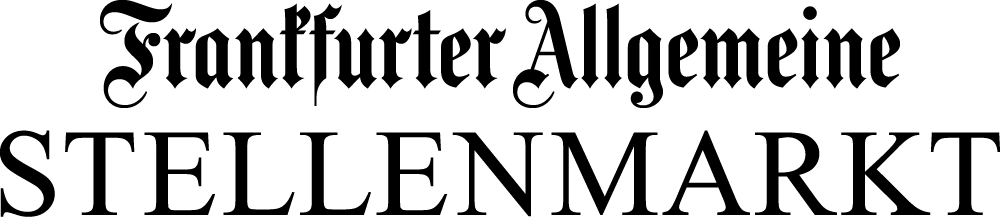Korrekturen ausgeschlossen

Wie bekommt man heute einen Job? Erfahrungen und Intuition spielen keine Rolle mehr. Die Bewerber werden berechnet – mit tückischen Folgen: Ein Buchstabendreher, und man ist raus.
Von Melanie Mühl
Jahrzehntelang wurde uns erzählt, der erste Eindruck sei entscheidend. Ob man einen Menschen kennenlernte oder sich um einen Job bewarb – es war dieser eine Moment, auf den es ankam. Es verstand sich von selbst, sich nicht nur akribisch auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten, sondern gleich auch einen neuen Anzug oder ein neues Kostüm zu kaufen.
Vergessen wir den ersten Eindruck. Vergessen wir die Ich-Erzählung überhaupt. Unsere Geschichten werden heute aus den Datenmassen geschrieben, die als wertvolle Handelsware über uns in Umlauf sind. Im algorithmisch optimierten Bewerberauswahlverfahren spielt auch der Mensch, der einem bislang im Bewerbungsgespräch gegenübersaß, der einen nach der Motivation befragte und danach, warum ausgerechnet man selbst hervorragend geeignet sei für diesen Job, eine lächerliche Nebenrolle. Gespräche produzieren keine Daten. Sie entziehen sich einer mathematischen Mustererkennung.
Im Big-Data-Zeitalter werten das viele als Nachteil. Es sind die Daten, die versprechen, den Menschen lesbar zu machen, sein Innerstes wie einen Code zu entziffern, in ihn zu blicken, als handelte es sich um einen Apparat, dessen Betriebsanleitung man nur richtig lesen muss. Ob man ein Buch verkaufen oder den nächsten Top-Angestellten finden möchte, spielt keine Rolle. Es geht nicht nur um das Hier und Jetzt, es geht vor allem um die Zukunft, um die Frage: Was wird sein? Also: Welcher Mensch wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Profit erwirtschaften? Alles hat einen Preis, das Buch und der Mensch.
Das ist spätestens bekannt, seit Stephen Baker in einer Recherche für die „Business Week“ herausfand, dass IBM mathematische Profile von Tausenden Mitarbeitern erstellt hat, um zu berechnen, was eine Person zum Spitzenangestellten macht. „Und wenn ein Mensch sich für einen Job als unzulänglich erweisen sollte, dann wird er eben umkonfiguriert – zuerst mathematisch und dann in der Wirklichkeit.“
Früher informierte man sich über das Unternehmen, bei dem man sich bewarb. Heute tut man das immer noch; die Unternehmen tun es umgekehrt allerdings auch. Die Bewerbungswelt mit ihren Durchleuchtungsverfahren namens Background Checks gründet auf Misstrauen, und das Misstrauen wächst: In den neunziger Jahren screenten etwa fünfzig Prozent der amerikanischen Arbeitgeber ihre Bewerber; heute sind es nach Angaben der amerikanischen Gesellschaft für Human Resource Management mehr als neunzig Prozent. Das Überprüfungsportfolio ist atemberaubend: HireRight durchkämmt Vorstrafen- und internationale Strafregister, Sexualverbrecherkarteien und Datenbanken, in der Ladendiebe geführt werden. Außerdem werden Hochschulabschlüsse und Bonität geprüft und ob Drogen- und Alkoholverstöße vorliegen. Und das sind lediglich ein paar Beispiele.
Die Datenmassen, die automatisiert verarbeitet werden, entziehen sich jeder Vorstellungskraft. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei Fehler passieren, steigt. Das bedeutet, dass immer wieder Menschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Dass sie plötzlich auf der Straße stehen, ohne Job, ohne Krankenversicherung, ohne Dach über dem Kopf. Ein Buchstabendreher im Namen kann zu einer völlig falschen Einschätzung einer Person führen. Mit dem Ergebnis, dass diese Person keinen Kredit bekommt, keine Wohnung, keine Arbeit. LexisNexis, eine Firma, die jährlich die Vergangenheit von mehr als zwölf Millionen Menschen unter die Lupe nimmt, gibt an, dass weniger als ein Prozent der Ergebnisse nicht korrekt sei – das sind aber etwa 120 000 Menschen, die Einwohnerzahl einer Stadt wie Ulm.
Es wäre leichtsinnig, die Diskriminierungsgefahr digitalisierter Bewertungsverfahren als amerikanisches Problem abzutun. Die Angst der Arbeitgeber, den vermeintlich falschen Bewerber einzustellen, wächst auch in Deutschland. Die Öffentlichkeit bemerkt davon nichts. In Berlin sitzt etwa die Signum Consulting GmbH, die Firma hat sich auf das Screening von Führungskräften spezialisiert. „Wie leicht war es doch im Mittelalter“, heißt es auf der Homepage, „ein Siegel unter ein Dokument gesetzt, und niemand zweifelte an der Rechtmäßigkeit und Gültigkeit. Im Zeitalter der modernen Medien sollten die Prüfmechanismen den Möglichkeiten angepasst werden.“
Wer die Signum Consulting GmbH beauftragt, hat die Wahl zwischen zwei Überprüfungsangeboten: der Basisüberprüfung und dem erweiterten Background Check bei Führungskräften. „Bei einem umfangreichen Background Check werden zusätzliche Informationen eingeholt und geprüft, die für das beauftragende Unternehmen von Relevanz sind, zum Beispiel: Referenzeinholung, Firmenbeteiligungen und wirtschaftliche/persönliche Verflechtungen zu anderen Unternehmen, relevante Verbindungen zu Personen oder Organisationen von besonderem Interesse.“
„Laut einer internen Statistik sind 25 Prozent der Angaben in Bewerbungen fehlerhaft“, sagt Eckhard Neumann, Geschäftsführer der Signum Consulting GmbH. Die Spanne reiche von gestreckten oder, bei Arbeitslosigkeit, verkürzten Zeiträumen bis hin zu Urkundenfälschung. Das Interesse deutscher Firmen am Pre-Employment-Screening sei vor bald vier Jahren richtig in Gang gekommen: 2009 wurde das Datenschutzgesetz novelliert; es erlaubt, dass im Auswahlprozess personenbezogene Daten von Bewerbern gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Firmen in Amerika erstellen standardmäßig „Social Media Profile“ ihrer Bewerber, sie screenen Facebook, Twitter und Instagram, was in Deutschland verboten ist. Nur: Wer will überprüfen, ob sich die Firmen tatsächlich daran halten? Man kann davon ausgehen, dass jede zugängliche Information abgegriffen wird, besonders in sozialen Netzwerken. Es geht dabei längst nicht nur um komprimierende Partyfotos; es geht darum, mit forensischer Genauigkeit charakterliche Widersprüche aufzudecken.
Eine Microsoft-Studie aus dem Jahr 2010 hat untersucht, welche Rolle die Online-Reputation Jobsuchender spielt. Befragt wurden Headhunter und Personaler aus Amerika, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Alle waren sich einig, dass die Bedeutung des Internets als Informationslieferant signifikant steigen wird. Siebzig Prozent der amerikanischen Personaler haben bereits Kandidaten aufgrund negativer Online-Recherchen abgelehnt, weil ihnen deren Lebensstil, Kommentare oder gepostete Fotos missfielen. Beunruhigend ist, dass sich 22 Prozent der befragten deutschen Personalentscheider weigerten, die Frage überhaupt zu beantworten.
Wer bei Xing oder Linkedin ist, bekommt hin und wieder Kontaktanfragen fremder Menschen. Wir tendieren dazu, sie anzunehmen. Ein Klick bedeutet, dass wir unter Umständen mit einer Person „befreundet“ sind, die bei Antikorruptionsjägern sehr weit oben auf der roten Liste steht. Der Einwand, man würde nur Kontaktanfragen von Personen annehmen, die man persönlich kennt, läuft ins Leere. Er blendet aus, dass wir automatisch auch mit Kontakten zweiten Grades in Verbindung gebracht werden: mit jenen Leuten, mit denen unsere eigenen Kontaktpersonen befreundet sind. „Ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb“, so drückt es Pam Dixon vom World Privacy Forum aus. „Sind alle Ihre Freunde schwul, reich, arm? Leben sie alle in Kalifornien, New York oder Kansas? Sehen sie nach Geld aus oder nach einem hohen Risiko?“ Der Traumjob, sagt Dixon, könne sich schnell in Luft auflösen. „Die Entscheidung des Arbeitgebers, Sie nicht einzustellen, mag, ethisch betrachtet, skandalös sein. Aber sie ist nicht illegal.“
Das Bewerbungsverfahren hat sich in den vergangenen zehn Jahren grundlegend verändert. Bei vielen Konzernen sind Online-Bewerbungen mittlerweile die Regel. Man muss sich das Verfahren wie eine Rasterfahndung vorstellen. Nur wer die Anforderungen exakt erfüllt, wird nicht von der Software aussortiert. Die Versuchung, falsche Angaben zu machen, um nicht sofort rauszufliegen, sei groß, sagt Neumann. Die Maske auf dem Bildschirm kennt keinen Verhandlungsspielraum. Es ist ein System der Inklusion und Exklusion. Die Kreuze müssen lediglich an den richtigen Stellen gemacht werden. Aber was sagt das am Ende über das Talent, die Kreativität und das Potential eines Menschen tatsächlich aus?
Nüchtern betrachtet, geschieht bei der vermeintlich optimierten Bewerberauswahl gerade Folgendes: Wir tauschen die eine Strategie, mit Unwissenheit umzugehen, gegen eine andere aus, die nicht weniger Unsicherheit birgt. Denn auch bei der technologischen Vermessung des Menschen geht es um Wahrscheinlichkeiten. Nur glauben wir dieses Mal eben nicht in erster Linie dem Bewerber im persönlichen Gespräch, sondern der Geschichte, die uns die Maschine über ihn erzählt. Das Dumme dabei ist, dass die Maschine nicht nachfragt.