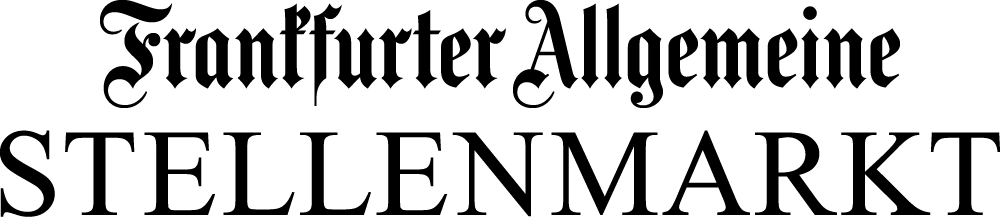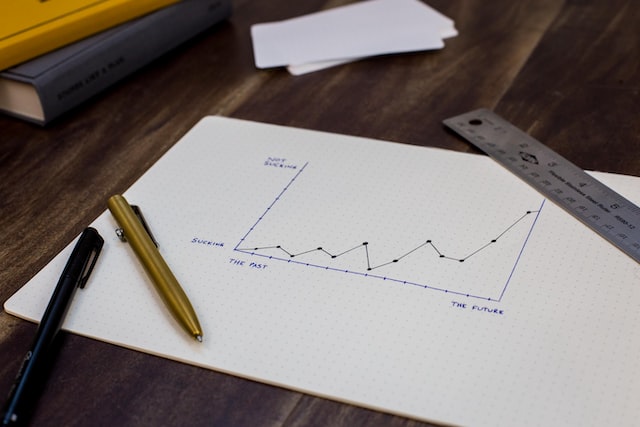Der Chef kommt jetzt aus China

Wie nie zuvor kaufen sich Staatsunternehmen aus der Volksrepublik im deutschen Mittelstand ein. Wie kommen Manager hierzulande mit dem Kulturbruch klar?
Von Ulrich Friese und Oliver Schmale
Als sich Ende Februar Shanghai Electric beim schwäbischen Maschinenbauer und Apple-Zulieferer Manz AG einkaufte, wusste Vorstandschef Dieter Manz, was ihn erwartet: „Verhandlungen mit Geschäftspartnern im Ausland sind in China stets Chefsache. Sie können sich daher länger hinziehen, und die eigentlichen Ziele werden dabei selten so direkt angesteuert, wie das bei uns im Westen üblich ist“, berichtet er nach langjährigen Erfahrungen vor Ort. Die stärksten Unterschiede zwischen beiden Unternehmenswelten offenbaren sich laut Manz im Führungsstil. Danach bestimmen selbst im mittleren Management der global tätigen Konzerne strikte Vorgaben wie „Hierarchien achten“ oder „das Gesicht wahren“ bis heute den Arbeitsalltag.
Die Einkaufswelle rollt. Seit Jahresbeginn vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein chinesischer Konzern eine größere Übernahme im Ausland ankündigt. Erste Anlaufadresse für die kapitalkräftigen Interessenten aus Fernost ist Europa. Allein im vergangenen Jahr stiegen ihre Direktinvestitionen hierzulande um 44 Prozent auf 20 Milliarden Euro, wobei in Deutschland die mittelständischen, auf Hochtechnologie spezialisierten Betriebe ganz oben auf der Agenda stehen. Sie genießen in der Volksrepublik großen Respekt und einen exzellenten Ruf.
Das Volumen dürfte sich im laufenden Jahr kräftig erhöhen. Während etwa Chinas Chemieriese Chemchina im Februar den deutschen Maschinenbauer Krauss Maffei für eine Milliarde Euro kaufte und wenige Tage später den Schweizer Pflanzenschutz-Spezialisten Syngenta für den stolzen Betrag von 45 Milliarden Dollar schluckte, sorgte in der deutschen Industrie Bejing Enterprises für einen weiteren Paukenschlag: Die chinesische Staatsholding legte sich den niedersächsischen Müllverbrenner EEW für 1,4 Milliarden Euro zu – die bislang größte Transaktion hierzulande.
Die Einkaufsliste lässt sich beliebig fortsetzen. Schließlich war Deutschland schon 2015 das – gemessen an der Zahl der Transaktionen – beliebteste Übernahmeland für chinesische Investoren, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung von Ernst & Young. In jüngster Zeit haben sich allerdings die Übernahmeziele verändert. Im Gegensatz zu früheren Einkaufstouren, in denen marode Betriebe aus der Insolvenz herausgekauft wurden, um veraltete Technik in der Heimat zu ersetzen, stehen jetzt Branchenpioniere mit hoher Spezialisierung oder Nischenanbieter mit exklusivem Marktzugang im Fokus.
Unter den Zukäufen der jüngsten Zeit dominieren die deutsche Schlüsselindustrien wie Autozulieferer (Kiekert), Wasser- und Umwelttechnologie (Bilfinger, EEW) oder Spezialisten im Maschinenbau (Putzmeister, Schwing). „Viele Konzerne legen sich ein Portfolio an europäischen Unternehmen zu, um so ihre Wertschöpfungsketten oder die globalen Vertriebskanäle zu erweitern“, sagt Yi Sun, die als Partnerin von Ernst & Young Kunden aus dem Reich der Mitte bei ihren Einkaufstouren in Europa berät.
Wichtigste Kraft für den Expansionsdrang nach Europa sind chinesische Staatskonzerne, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent den Löwenanteil der Auslandsinvestitionen ausmachen, heißt es in einer Studie des China-Forschungsinstitutes Merics in Berlin. Für viele Mittelständler in Deutschland ist das ein Vorteil: Anders als Finanzinvestoren oder börsennotierte Unternehmen haben die staatlich geführten Aufkäufer eine langfristige Orientierung: „Es geht nicht um eine schnelle Wertsteigerung für die Aktionäre, sondern um die Pflege des erworbenen Knowhows“, bringt Merics-Experte Mikko Huotari die Lage auf den Punkt. Doch für Kritiker solcher Einkaufstouren ist die starke Präsenz von Staatsunternehmen, deren Bilanzen für westliche Fachleute kaum durchschaubar sind, mit hohen finanziellen Risiken verbunden.
Für das Gros der Mittelständler sind solche Eigentümerwechsel auch mit einem kulturellen Wandel verbunden. Dennoch stehen chinesische Hausherren bei deutschen Managern, Betriebsräten oder Gewerkschaftsführern oftmals hoch im Kurs. Im Kontrast zum eher hemdsärmelig-ruppigen Stil von amerikanischen Unternehmen, die in Deutschland ebenfalls seit Jahren auf Einkaufstour sind, gelten ihre Pendants aus der Volksrepublik eher als Leisetreter in den Chefetagen: „Sie sind bereit, geduldig zuzuhören, und bemüht, Details zu verstehen und komplexe Sachverhalte zu erfassen“, berichtet Dietrich Eickhoff, der über vielfältige Erfahrungen im In- und Ausland verfügt. Er arbeitete beim deutschen Maschinenbauer FAG und dem amerikanischen Caterpillar-Konzern, bevor er an die Spitze des Textilherstellers Dürkopp Adler rückte und Statthalter eines asiatischen Eigentümers wurde. Denn das Unternehmen aus Bielefeld gehört seit Jahren zur Shang-Gong-Gruppe aus Schanghai.
Auch aus Sicht von Betriebsräten, deren Unternehmen vom Reich der Mitte aus gesteuert werden, hat sich die Sorge um Arbeitsplatzabbau durch die Verlagerung der Produktion ins kostengünstigere Ausland zumeist verflüchtigt. Zumindest gebe es aus gewerkschaftlicher Sicht keinen Grund, Investoren aus China zu verteufeln, heißt es in einem internen Fazit der IG Metall. Sie lassen ihren Statthaltern viel unternehmerische Freiheit und vertrauen der nationalen Expertise deutscher Kollegen.
„Im Regelfall lassen chinesische Investoren das deutsche Management im Amt“, sagt Beraterin Sun. Ausnahmen sind dagegen in Familienunternehmen zu finden, wenn etwa der Unternehmer über einen Verkauf sein internes Nachfolgeproblem elegant lösen will. Reibungslos verlief auch der Eigentümerwechsel bei der Flex-Elektrowerkzeuge GmbH im schwäbischen Steinheim/Murr. Bei dem Unternehmen, das mit 330 Mitarbeitern etwa 70 Millionen Euro im Jahr umsetzt, ist vor drei Jahren die chinesische Chervon Holding eingestiegen. Doch auch unter neuer Regie musste Geschäftsführer Andreas Ditsche um seinen Posten nicht bangen, wenngleich er seitdem große Unterschiede in der Firmenkultur registriert: „In China wird im Tagesgeschäft stärker im Team und mit gemeinsamer Verantwortung und Entscheidungsfindung gearbeitet“, sagt er. „In Deutschland dagegen konzentriert sich die Verantwortung auf einzelne Personen.“
Größte Herausforderung im Umgang mit den neuen Hausherren ist zudem das Sprach- und Kulturproblem. Ditsche und einige Kollegen haben seit dem Einstieg versucht, mindestens einmal in der Woche die chinesische Sprache zu lernen. Mit mäßigem Erfolg. Angesichts der Fülle und Vielfalt an Schriftzeichen, von denen selbst Muttersprachler nur einen Bruchteil kennen, sowie diverser Tücken bei der Aussprache haben viele Teilnehmer nach wenigen Wochen kapituliert. Wenigstens drei Führungskräfte von Flex sind laut Ditsche in der Lage, einige Schriftzeichen zu deuten und einfache Sätze zu formulieren. „Für die Praxis im Geschäftsalltag reicht das nicht“, gibt er zu. Aufgeben ist aber keine Alternative. Schließlich hilft der Umgang mit der Sprache, das Verhalten und den kulturellen Hintergrund des neuen Eigentümers zu verstehen.
„Unsere Muttergesellschaft greift nicht in das Tagesgeschäft ein“, beschreibt Ditsche die aktuelle Arbeitsteilung. Stattdessen schalten sich chinesische Manager vor allem bei der Kalkulation von Budgets und beim internen Berichtswesen ein. Ein Umstand, der sich aus Gründen der unterschiedlichen Rechnungslegung für deutsche und chinesische Unternehmen zwingend ergibt. Eine Mitarbeiterin der Mutterholding ist daher bei den Schwaben im kaufmännischen Bereich tätig, um für schnellen Datenaustausch zwischen beiden Welten zu sorgen.
Auch wenn der innerbetriebliche Austausch in den meisten Fällen glatt verläuft, ist die Unsicherheit auf deutscher Seite groß ist, wenn der persönliche Kontakt mit dem Investor aus dem Reich der Mitte ansteht. Aus der Sicht von EY-Beraterin Sun sind solche Berührungsängste mit der unterschiedlichen Arbeitsethik in beiden Ländern zu begründen. „In Deutschland haben die Führungskräfte mehr Urlaub als ihre Kollegen in Asien und nach Feierabend Wichtigeres zu tun, als nur an das Wohl des Unternehmens zu denken“, sagt sie.
Nicht selten wächst dann auf chinesischer Seite der Unmut darüber, warum die deutschen Statthalter nicht rund um die Uhr erreichbar sind oder für Sondereinsätze in vermeintlichen Krisenfällen außerhalb der Dienstzeit kaum zur Verfügung stehen. Gewöhnungsbedürftig aus deutscher Sicht ist dagegen die Tatsache, dass ein starker Einfluss des Chefs in einem chinesischen Konzern nicht nur die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben aufweicht, sondern regelmäßig auch für ein (kollektives) Verhalten bei öffentlichen Auftritten und gesellschaftlichen Anlässen sorgt. „Wenn bei einem Geschäftsessen in China der Chef auch bei einer wenig amüsanten Anekdote lacht, müssen alle Mitglieder aus seinem Team mitlachen“, nennt Sun ein griffiges Beispiel. Ein solcher Gruppenzwang ist für Mitarbeiter in deutschen Unternehmen kaum nachvollziehbar.
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de