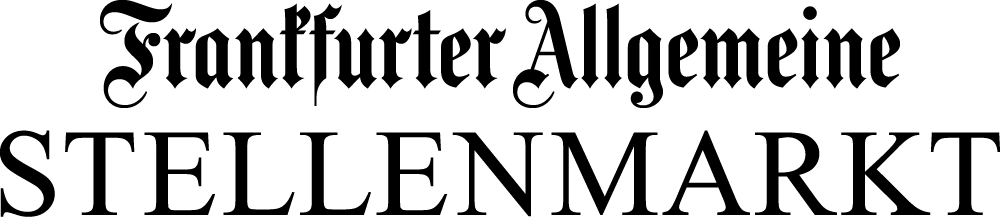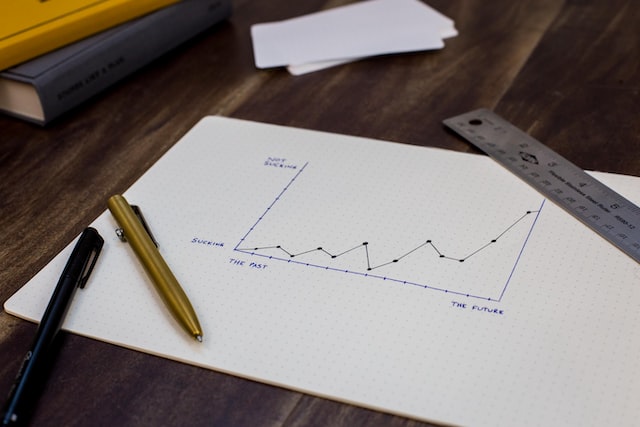Schlips und Sitten im Management

Nikolaus von Bomhard ist eine Ausnahmeerscheinung unter Deutschlands Konzernchefs. 13 Jahre stand er an der Spitze der Munich Re. Zum Abschied redet über Moden im Management, unverschämte Gehälter, die Sorge vor dem nächsten Crash – und warum er in die Oper radelt.
Herr von Bomhard, lassen Sie uns über guten Stil reden und wie sich die Manager-Moden geändert haben.
Gern. Die Konnotation von Stil ist ja gar nicht mehr so positiv heute. Wer versucht, Mindeststandards zu halten, kommt nicht unbedingt gut an.
Beginnen wir mit den Äußerlichkeiten: Manager heute sind rank und schlank, die Zeit der zigarrenrauchenden Dickbäuche aus Wirtschaftswunderzeiten ist vorbei.
Richtig. Das Durchschnittsgewicht unseres Vorstandes hat deutlich abgenommen. Überhaupt sehen Sie kaum noch Manager mit Übergewicht, rauchen tut ohnehin keiner, Alkohol wird gemieden, die Lebensgewohnheiten haben sich geändert.
Die Chefs treiben Sport?
Die allermeisten, ja.
Und sie tragen keine Krawatte mehr.
Mag sein. Wir nehmen uns allerdings die Freiheit, auf diesen Trend nicht aufzuspringen.
Warum nicht?
Jeder soll das so halten, wie es für den eigenen Geschäftsbereich angemessen ist. In unseren Innovationsbereichen oder in der IT werden Sie sich schwertun, einen Kollegen mit Krawatte zu finden. Wenn wir aber Kunden mit Krawatte gegenübertreten, und das ist bei den meisten Kunden weiter der Fall, dann auch mit Krawatte. Überhaupt keine Frage.
Und wenn ein Vorstandskollege ohne Schlips auftaucht, dann gucken Sie streng?
Das ist eine hypothetische Frage, da dies noch nicht der Fall war.
Als Sie angefangen haben, war die „Deutschland AG“ noch intakt, die Konzerne waren untereinander mit den Banken verflochten: Heute ist dies außer Mode – gut oder schlecht?
Die Deutschland AG würde ich nicht als Modeerscheinung sehen, sondern als Relikt der Nachkriegszeit, das sich lange gehalten hat. Geboren aus der Notwendigkeit, sich zu finanzieren, hat die Finanzwirtschaft sich bei Unternehmen engagiert, über Eigenkapital und Kredite. So entstand dieses Netzwerk, und deshalb war die Finanzwirtschaft auch so stark präsent in den Aufsichtsräten. Für die Beaufsichtigung der Unternehmen war das nicht immer gut.
Stattdessen hielten das amerikanische Shareholder-Value-Denken und die Gier Einzug in deutsche Firmen.
Zeitlich fallen die Auflösung der Deutschland-AG und der Trend zum Shareholder-Value-Denken in der Tat zusammen, und auch sachlich gab es eine Verbindung: Die Unternehmen stießen an Grenzen der Finanzierbarkeit, man brauchte ausländisches Kapital. Das ausgeprägte Shareholder-Value-Denken, das es vorher so nicht gab, hat nicht nur Gutes bewirkt, denn das Pendel ist mancherorts in das andere Extrem durchgeschwungen. Der Shareholder-Value-Geist führte zu Auswüchsen, diese Kritik teile ich.
Wo konkret sehen Sie Exzesse?
In der extremen Verengung der Sicht allein auf die Aktionäre. Das ist für kein Unternehmen gut, weil es mit sehr viel mehr Betroffenen, neudeutsch Stakeholdern, zu tun hat. Es geht um Mitarbeiter, Kunden, die Öffentlichkeit und natürlich auch die Aktionäre. Wenn man diese oft verschiedenen Interessen nicht gut austariert, läuft man Gefahr, Gruppen zu verlieren.
Aber genau das ist Ihrer Meinung nach passiert?
An manchen Stellen ja. Einzelne Manager waren zu weit weg von Kunden oder Mitarbeitern oder haben ihre Pflichten gegenüber dem Gemeinwohl nicht sehen wollen. Man hat dem Aktionär vermeintlich Gutes getan – aber nur kurzfristig, auf mittlere Sicht hat sich das gerächt.
Wer als Manager das Vermögen seiner Eigentümer im Blick hat, muss erst recht auf die Kunden achten. Schließlich braucht er sie, um Geld zu verdienen.
Das müsste man meinen, ist aber nicht immer so. Den Gewinn kann ich kurzfristig optimieren zu Lasten der anderen Betroffenen, auch zu Lasten der Kunden. Wenn ich keinen Cent auf dem Tisch lassen will, dann leidet letztlich der Kunde. Mittelfristig wird da mit Zitronen gehandelt.
Heute bekennt sich kaum noch ein Konzernchef zum puren Shareholder-Value-Denken, alle reden von den Stakeholdern: Ist das die neueste Mode?
Das Austarieren der Interessen würde ich nicht als Mode bezeichnen. Mode braucht Übertreibungen, das ist gerade bei diesem Konzept nicht der Fall. Im Übrigen wird inzwischen Unternehmensführung immer komplexer, da sich unendlich viele Interessengruppen melden, permanent müssen wir uns rechtfertigen: Dürfen wir in bestimmten Ländern aktiv sein? Können wir bestimmte Infrastrukturvorhaben versichern? Dürfen wir bestimmte Kapitalanlagen tätigen? Ist die Vergütung angemessen? Und so fort.
Die zeitgeistigen Moralisierer haben Einfluss gewonnen. Müssen sich Unternehmer dem beugen?
Es gibt insofern Übertreibungen, als Themen dank geschickter medialer Vermarktung eine Aufmerksamkeit bekommen, die in keinem Verhältnis steht zu deren Bedeutung. Zudem werden bestimmte Fragen moralisch derart aufgeladen, dass es trotz guter Argumente schwierig ist, sachlich zu argumentieren, ohne in eine Ecke gestellt zu werden. In meiner Position aber kann ich nicht rein gesinnungsethisch argumentieren, ich muss die Verantwortung für das Ganze im Auge behalten.
Die Macht der Lobbygruppen und NGOs ist größer geworden im Lauf der Jahre, richtig?
Mit Sicherheit ja, auch weil sie professioneller auftreten. Dabei fiel es mir zuletzt manchmal nicht leicht, zwischen dem Einsatz für die Sache selbst und der Wahrnehmung von Eigeninteressen bei einzelnen Organisationen zu unterscheiden.
Der Zwang für Manager, politisch korrekt zu reden, jedenfalls wächst.
Zweifellos. Und das ist nicht immer gut. Dieses übermäßig politisch Korrekte schneidet an den Rändern Diskussionen und wesentliche Inhalte ab.
Täuscht der Eindruck, dass Konzernchefs genötigt werden, sich vermehrt öffentlich zu äußern, ihre Aussagen aber immer unverbindlicher werden?
Erstens: Man erwartet von den Chefs großer Unternehmen, dass sie in der Öffentlichkeit Stellung beziehen. Das halte ich für legitim. Die Kunst besteht für Menschen in meiner Position darin, die Mitte zu finden – zwischen nicht präsent sein und es zu übertreiben mit den Auftritten. Wir sprechen ja immer nur für das Unternehmen, davon leitet sich alles ab, es geht nicht um einen selbst. Diese Bescheidenheit muss man sich als Konzernchef bewahren. Wenn Sie, zweitens, meinen, dass Manager heute nichtssagender reden, dann bestreite ich das: Gerade in letzter Zeit äußern sich Wirtschaftsvertreter wieder deutlicher, wobei die Öffentlichkeit, auch die Politik, gemerkt hat, dass man nur gehört wird, wenn Klartext gesprochen wird. Man muss als Manager bereit sein anzuecken.
Wenn die Politik die Managergehälter begrenzen will und damit in das Recht der Eigentümer eingreift, wagt kein Manager, sich dagegen zu wehren.
Das stimmt nicht. Wir haben schon damals gegengehalten, als es in der Politik darum ging, die Gehälter einzelner Vorstandsmitglieder öffentlich auszuweisen. Unser Hauptargument war: Die Gehälter werden hierdurch in die Höhe getrieben.
Genauso ist es gekommen.
Natürlich. Das war klar. Man hat unterschätzt, dass es den Menschen, auch Managern, nicht um die absolute Höhe des Gehalts geht, sondern um den Vergleich, den Abstand zu den anderen. In dem Moment, in dem ich erkenne, ein anderer bekommt mehr, entsteht der Wunsch: ich auch. So hat sich diese Spirale nach oben entwickelt. Das war vorhersehbar.
Haben Sie selbst davon auch profitiert?
Ja, sicher, auch mein Gehalt ist gestiegen, auch wenn wir darauf achten, dass wir bei unserer Vergütung bei Munich Re Maß und Mitte bewahren. Munich Re ist bislang nie ernsthaft für zu hohe Managergehälter kritisiert worden. Wir liegen bei der Höhe der Vergütung des Vorstands seit Jahren am Beginn des unteren Drittels im Dax. Wir hatten auch immer Obergrenzen für Boni. Aber auch bei uns hat die beschriebene Spirale nach oben gewirkt. Unser Aufsichtsrat meinte, wir müssen mehr bezahlen, wenn wir beim Börsenwert in der Mitte des Dax liegen und bei den Gehältern unter den Schlusslichtern.
Der Aufsichtsrat hätte doch auch sagen können: Herr von Bomhard, Sie werden anständig bezahlt, das muss reichen.
Wir im Vorstand haben von uns auch nie mehr Geld gefordert, wahrscheinlich hätte ich auch für weniger gearbeitet, das stimmt.
Warum wird dann mehr bezahlt? Weil sonst die Besten nicht zu Ihnen kommen?
In Deutschland haben wir da kein Problem, schwieriger ist es im Ausland. In einigen Märkten liegen wir weit unter dem dort üblichen Gehaltsniveau, besonders in der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Von dort können wir keine Spitzenmanager bei anderen Unternehmen abwerben, die würden sich vom Gehalt her zu sehr verschlechtern.
Sie haben einmal gesagt, dass Manager sich schämen sollten, in Verlustjahren Boni zu kassieren. Gilt das noch immer?
Selbstverständlich: Wer Verlust macht, hat keinen Bonus verdient. Ich hatte Jahre, wo mein Jahresbonus für den Unternehmenserfolg bei null lag – und wir wiesen nicht mal einen Verlust aus. Alles andere gehört sich nicht.
Angeeckt sind Sie auch mit Ihrer ungewöhnlich scharfen Kritik an der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank: Haben diese Angriffe etwas gebracht?
Genützt hat es leider überhaupt nichts, weil die EZB ihre Politik ja immer noch so fortsetzt, wie wir Tag für Tag leidvoll beobachten müssen. Geholfen hat es nur insofern, als dass die Diskussion lebendig blieb, da auch andere den Mut haben, sich gegen den verhängnisvollen Kurs der EZB zu äußern. Geschmerzt hat mich allerdings, dass uns teilweise unterstellt wurde, dass wir die EZB nur aus egoistischen Motiven angreifen, da der Nullzins Teile unseres Geschäfts bedroht.
Das tut er doch.
Natürlich sprechen wir auch als Betroffene, im Interesse unserer Kunden. Aber unsere Kritik setzt viel grundsätzlicher an: Wir halten die herrschende Geldpolitik per se für gefährlich, vor allem weil der Zins als Maß für das Risiko ausgeschaltet wird. Wohlgemerkt: Am Anfang, in der akuten Krise, musste die EZB so handeln, sie musste erhebliche Liquidität bereitstellen, die Lage war ernst. Aber das ist jetzt zehn Jahre her. Es ist längst an der Zeit, andere Signale zu senden.
EZB-Präsident Mario Draghi behauptet, er mache alles richtig: Die Wirtschaft wächst, die Inflation nähert sich dem Ziel von zwei Prozent.
Ja, ja. Die EZB sagt immer: „Es wirkt, was wir tun.“ Das Gegenteil kann ich zwar auch nicht beweisen. Aber ich würde sagen: Die wirtschaftliche Erholung hat wenig mit der EZB zu tun. Im Gegenteil: Vieles wäre besser, hätte sie nicht so viel getan. Dann wären beispielsweise die Reformen in den schwächeren Euroländern zügiger vorangekommen.
Sie haben den Euro zum Start als wichtig und gelungen bezeichnet. Sehen Sie das nach den Milliarden teuren Rettungen immer noch so?
Im Prinzip ja, auch wenn sich die Hoffnung nicht erfüllt hat, dass der Euro eine Konvergenzwelle innerhalb der Währungsunion auslöst. Trotzdem stehe ich zum Euro. Er war und ist ein wichtiges politisches Projekt, ich halte ihn auch wirtschaftlich für eine kluge Idee. Es muss nur einiges nachgeliefert werden. Die Liste dafür ist lang. Viel gewonnen wäre schon, wenn die Eurostaaten wenigstens die selbstgesetzten Regeln einhalten würden.
Nach Finanz- und Euro-Krise hat man sich geschworen, künftig vorsichtiger mit Risiken umzugehen: Wir können nicht erkennen, dass sich Grundlegendes geändert hat . . .
. . . ich fürchte, da haben Sie recht. Anfangs, in den Jahren nach dem Lehman-Schock, waren die Aufschläge für riskantere Anlagen durchaus heftig, bis zum Jahr 2011 etwa. Das hat sich längst wieder gelegt, auch wegen der reichlich vorhandenen Liquidität, die von den Notenbanken in den Markt gepumpt wurde. Die Risikobewertung für viele Anlagearten ist bei weitem nicht mehr angemessen. Das ist nicht gesund. Das zu hohe Kursniveau wird sich irgendwann wieder auflösen. Selbst wenn der Kurssturz nicht abrupt kommt, er wird vielen Anlegern enorm weh tun.
Wem wird das wie weh tun?
Allen, die diese Anleihen halten. Dann wird sich das heute oft aufgeblähte Eigenkapital in Luft auflösen, etwa in der Finanzbranche. Wir, als Munich Re, sind darauf vorbereitet.
Wollen Sie damit sagen: Uns steht der nächste Crash bevor, die nächste Finanzkrise?
So weit gehe ich nicht, aber vieles hängt an einem dünnen Faden. Die Politik in Amerika ist erratisch, niemand weiß, was wirklich kommt. Und wer kann sagen, wie sich die Volkswirtschaft in China entwickeln wird? Die Wahlen in Frankreich bergen ein Risiko, und danach wird garantiert Italien wieder in den Fokus geraten.
Die Börsen aber bewegen sich auf Höchstständen. Sind die Märkte blind?
Natürlich verdienen derzeit viele Unternehmen ordentlich und die Weltwirtschaft erholt sich, aber wie gesagt: Das Umfeld ist unsicher. Es braucht nicht viel, um das fragile Gleichgewicht zu stören. Und das macht mir Sorgen. Denn welchen Spielraum haben die Notenbanken und Staaten noch, um in der nächsten Krise zu helfen? Der ist praktisch nicht mehr existent.
Viele Leute bringen ihr Geld mit Immobilien in Sicherheit. Ist es da wirklich sicher, oder sind die Preis da auch jenseits von Gut und Böse?
Es fällt mir schwer, das zu beurteilen, zumal ich kein Immobilienexperte bin. Aber man fragt sich schon, wie lange das noch gutgehen kann, nachdem die Preise, wie hier in München, so enorm gestiegen sind. Die Immobilienmärkte in Deutschland sind allerdings im internationalen Vergleich ungewöhnlich, denn die Schwankungsbreite der Preise ist gering. Das dämpft die Risiken.
Würden Sie jetzt noch Häuser kaufen?
Darüber habe ich nicht nachgedacht, vielleicht ist das auch eine Antwort.
Gab es in Ihrem Berufsleben Phasen, wo Sie nachts wach lagen und gezweifelt haben: Ob ich das packe?
Das Schwierigste waren immer die Personalentscheidungen, mit großem Abstand, selbst größere Übernahmen sind insofern weniger herausfordernd. Wenn ich schlaflose Nächte hatte, dann immer wegen solcher Fragen: Wer wird am besten wo eingesetzt?
Haben Sie sich auch vergriffen?
Natürlich, ich verrate Ihnen aber nicht, wo. Auch bei Mitarbeitern, deren Arbeit man jahrelang kennen- und schätzengelernt hat, ist es eben keineswegs sicher, dass sie ihre Leistung auch in einer anderen, exponierteren Funktion abrufen können. Manchmal ist es gerade der nächste Schritt in einer Karriere, der Menschen an ihre Grenzen bringt.
Solche Leute müssen gehen, sie können nicht zurück ins Glied?
Meistens. Aber wir versuchen, auch andere Lösungen zu finden, denn es ist bitter, Mitarbeiter zu verlieren, die jahrelang gute Leistungen gebracht haben.
Also schickt man sie in die Verbannung ins Ausland nach Übersee?
Abstand hilft, Luftveränderung hilft. So gesehen, ist das in der Tat eine Möglichkeit, wobei unser Auslandsgeschäft sehr bedeutend ist, also zum Ausruhen kommt dort niemand.
Darf jemand Fehler machen bei Ihnen?
Wenn es um Milliardenbeträge geht, dann nicht; im Innovationslab jedoch geht es gar nicht ohne. Wenn das Unternehmen mit sehr hohen Beträgen ins Obligo gesetzt wird, muss die Fehlerquote null sein.
Zu Ihrem persönlichen Stil gehört es, dass Sie ins Büro radeln. Aus Anbiederung an den Zeitgeist?
Nein, da war ich dem Zeitgeist voraus. Für mich ist das Fahrrad das mit Abstand schnellste Verkehrsmittel von mir zu Hause ins Büro. Außerdem bewege ich mich gern im Freien. Ich bin auch schon im Smoking zu einer Kundenveranstaltung in die Oper geradelt. Deswegen muss aber nicht jeder im Unternehmen Fahrrad fahren.
Sonst würden auch die Fahrer der Dienstlimousinen arbeitslos.
Wir haben ohnehin nur einen Fahrer, für zehn Vorstandsmitglieder und unsere Gäste.
Früher gehörte es sich, dass jeder Herr Direktor selbstverständlich einen eigenen Chauffeur hat.
Diese Tradition gab es bei Munich Re nie, auch wenn wir früher etwas mehr als einen Fahrer hatten.
In jenen Zeiten waren die Regeln auch in privaten Dingen strikt: Deutsche-Bank-Chef Herrhausen musste vor den Vorstand treten, als er sich von seiner Ehefrau trennte, und fragen, ob er künftig als Vorstandssprecher noch tragbar sei. Das wäre heute undenkbar, oder?
Die Konsequenz einer Niederlegung des Mandats wäre wohl nicht das Thema, aber man würde darüber sprechen. Allein schon, weil wir gegenseitig unsere Frauen kennen, und die Frauen sich auch untereinander.
Das Private spielt ins Geschäftliche hinein?
Umgekehrt würde ich sagen: Das Geschäftliche spielt ins Private rein.
Insgesamt aber sind die Sitten lockerer geworden. Ist das Fortschritt oder Werteverfall in Ihren Augen?
Manches ist leichter, lockerer geworden, anderes dafür anstrengender. Früher haben die Regeln ein Korsett gegeben, das man vielleicht nicht mochte, aber immerhin war damit vieles klar. Heute sind viele Bereiche freier, aber eben auch grauer. Da braucht man für sich einen Kompass, und das Unternehmen eine erlebbare Kultur. Die gibt Orientierung bei Unsicherheit, im Graubereich, und differenziert das Unternehmen auch nach außen, das ist wichtig.
Wie hat diese Kultur auszusehen?
Sie muss zum Unternehmen und seinem Geschäft passen. Die Finanzbranche ist generell etwas konservativer im Auftritt, Rückversicherer stehen im besonders konservativen Lager.
Was verstehen Sie unter „konservativ“?
Werte wie Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Respekt, auch Pünktlichkeit. So sind beispielsweise dem Kunden einmal gegebene Zusagen einzuhalten, auch wenn sich diese im Nachhinein für einen selbst als finanziell nachteilig herausstellen sollten. Auf diese Kultur hat der Vorstandsvorsitzende als der oberste Diener des Unternehmens zu achten. Und darauf, dass wir nicht dem Zeitgeist hinterherhecheln, auf jeden Trend aufspringen. Das bedeutet aber nicht, zu leugnen, dass die Welt sich verändert. Das Thema Digitalisierung als Mode abzutun wäre extrem gefährlich, geradezu existenzgefährdend.
Dass Sie Münchner Rück in Munich Re umbenannt haben, verträgt sich gerade noch mit der Tradition?
Wir haben in der Rückversicherung weit über 90 Prozent internationale Kunden. Der traditionelle Name Münchener Rück konnte draußen in der Welt weder geschrieben noch gesprochen werden, ein Zungenbrecher.
Redet der Vorstand deshalb durchgängig Englisch?
Nein, wir reden im Vorstand zumeist Deutsch.
Auch die Ausländer?
Sie sprechen Englisch, wenn sie das wollen, aber sie verstehen Deutsch. Grundsätzlich wird bei Munich Re selbstverständlich Englisch gesprochen, sobald auch nur ein einziger Kollege involviert ist, der kein Deutsch kann. Aber wir zwingen zwei Münchner Mitarbeiter nicht, sich auf Englisch zu unterhalten.
Und wie halten Sie es mit dem Duzen? Auch Traditionskonzerne übernehmen jetzt diese Mode von den Start-up-Firmen.
Ich würde das nie für ein Unternehmen anordnen, das soll jeder halten, wie er will. Mich selbst duzen wenige, auch weil ich es selbst im Geschäftlichen nicht forciere. Ich wollte schon als junger Mitarbeiter von meinen Vorgesetzten nicht geduzt werden, ich fand das immer unangenehm. Andere finden das klasse. In der nächsten Generation hier im Vorstand wird sicher mehr geduzt.
Ihr Arbeitsverhältnis endet nach 13 Jahren als Vorstandsvorsitzender am kommenden Mittwoch mit der Hauptversammlung. Wie vertreiben Sie sich die Zeit, bis Sie in zwei Jahren als Aufsichtsrat zurückkehren?
Man wird dann sehen, ob ich zurückkomme. Leider werde ich den Fortgang der angestoßenen Innovationen und den Erfolg des Ergo-Strategieprogramms nur als externer Beobachter über den Gartenzaun verfolgen können. Ansonsten steht erst einmal eine Mischung aus interessanten Mandaten und privaten Aktivitäten an, privat habe ich einiges nachzuholen. Das Verheißungsvollste ist, die Kontrolle über den Kalender zurückzugewinnen, wieder selbst zu entscheiden, was man tut, und nicht mehr durchgetaktet zu sein.
Wie viele Ihrer Stunden sind von anderen vorgegeben?
In der jetzigen Welt klar über 90 Prozent.
Wie viele Stunden die Woche?
Im Durchschnitt etwa zwölf Stunden täglich im Büro, späterabends geht es zu Hause weiter, und auch das Wochenende ist belegt, wenn auch selten zu 100 Prozent.
Die junge Manager-Generation trennt strikt zwischen Beruf und Freizeit, ist pünktlich zur Gute-Nacht-Geschichte für die Kleinen zu Hause und hält das Wochenende für die Familie frei.
Wunsch und Realität dürften da oft auseinanderfallen.
Sie glauben das nicht?
Ich traue diesen Erzählungen nicht, beneide aber diejenigen, die es tatsächlich schaffen. Sicher ist: Wer das hinkriegen will, der muss es von Anfang an in seiner Karriere so halten. Ist man erst einmal Teil der Maschine, ist das kaum mehr zu ändern. So gesehen, wird das Leben demnächst schon angenehmer.
Das Gespräch führten Rainer Hank und Georg Meck.
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de