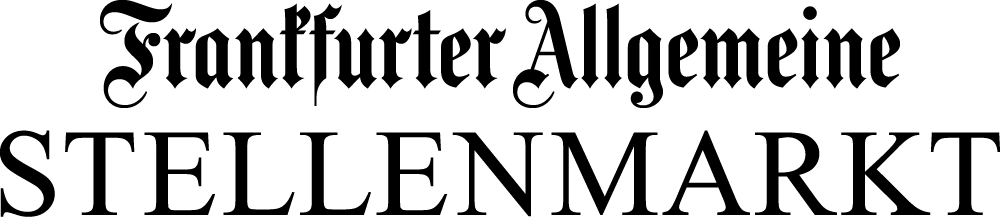Hauptsache, Vielfalt

Seit ein Google-Mitarbeiter den Diversity-Kult in seinem Unternehmen angeprangert hat, tobt in Amerika eine heftige Debatte. Gibt es solche Übertreibungen auch in deutschen Unternehmen?
Von Sven Astheimer und Roland Lindner
Es begann auf einem Zwölf-Stunden-Flug nach China. James Damore dachte über seinen Arbeitgeber Google nach. Den 28 Jahre alten Softwareentwickler störten die Diversity-Initiativen, mit denen der Internetkonzern versucht, mehr Vielfalt in seine Belegschaft zu bringen. Was in der Praxis heißt, den Anteil der Mitarbeiter zu erhöhen, die nicht männlich sind und weiße Hautfarbe haben – so wie er. Gerade erst hatte er dazu ein internes Seminar absolviert, das ihm irritierend und heuchlerisch vorkam. Es hieß, man dürfe dieses oder jenes nicht sagen, weil es sexistisch sei. Er fand, ihm sei der Eindruck vermittelt worden, als weißer Mann müsse man sich schämen. Also machte er sich auf dem Flug daran, seine Gedanken aufzuschreiben. So hat Damore in mehreren Interviews die Entstehungsgeschichte jenes Pamphlets beschrieben, mit dem er für einen öffentlichen Aufschrei gesorgt und Google in Erklärungsnot gebracht hat. Der Internetkonzern sah sich gezwungen, ihn kurzerhand zu entlassen.
Grund für den Rauswurf waren Passagen in der Abhandlung, die von manchen Lesern als frauenfeindlich gewertet wurden. Damore argumentierte, die Erklärung für den Mangel an Frauen in Technologieunternehmen wie Google liege womöglich nicht nur in Voreingenommenheit und Diskriminierung, sondern auch in biologischen Differenzen zwischen den Geschlechtern. Der Google-Vorstandsvorsitzende Sundar Pichai, der wegen der Aufregung seinen Urlaub abbrach, sagte dazu in einer Stellungnahme mit strengen Worten: „Zu suggerieren, eine Gruppe unter unseren Kollegen habe Merkmale, die sie biologisch weniger geeignet für diese Arbeit machen, ist beleidigend und nicht okay.“ Selbst Pichai gab aber zu, Damore habe mit Blick auf die Diversity-Initiativen des Unternehmens wichtige und diskussionswürdige Fragen aufgeworfen.
Das Vorgehen des Chefs hält der Psychologe Harald Ackerschott für übereilt. Durch den öffentlichkeitswirksamen Rausschmiss sei Damore geadelt worden, und das Thema nahm erst richtig Schwung auf. Im sozialen Netzwerk Twitter gab es nicht nur unter #fired4truth unzählige Sympathiebekundungen. Ein souveräner Vorgesetzter hätte Damore im persönlichen Gespräch deutlich gemacht, wo die Grenzen sind, findet Ackerschott. Zumal Pichai gute Argumente gehabt hätte. „Es gibt keine relevante Messgröße, die einen signifikanten Unterschied der Leistungen von Männern und Frauen darstellt“, sagt der Experte für Leistungsdiagnostik. Mit einer Ausnahme: Es sei nachgewiesen, dass sich bei Frauen während ihres Zyklus das räumliche Denken verändert. Was für die IT-Branche aber eine nachrangige Erkenntnis sein dürfte.
Tatsächlich drehten sich die Ausführungen um viel mehr als vermeintliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Damore argumentierte auch, dass Google in seinen Bemühungen, Frauen und ethnische Minderheiten zu fördern, selbst diskriminiere. Zum Beispiel mit Einstellungspraktiken, die dafür sorgten, dass die Messlatte für Kandidaten aus vermeintlich benachteiligten Kategorien niedriger angesetzt werde. Oder mit Seminaren im Unternehmen, die nur für Angehörige bestimmter Gruppen zugänglich seien. Weiter sagte Damore, Diversity dürfe nicht nur eine Frage von Geschlechter- oder Rassenzugehörigkeit sein. Wichtig sei es auch, eine Vielfalt von Standpunkten zu haben. Und genau das fehlt seiner Meinung nach bei Google. Im Unternehmen herrsche eine „politisch korrekte Monokultur“ und „linksliberale Voreingenommenheit“. Wer konservativ sei, müsse seine Positionen verheimlichen, wenn er sich nicht „offener Feindseligkeit“ aussetzen wolle.
Ebenso wie andere Unternehmen aus dem Silicon Valley will auch Google als Arbeitgeber erscheinen, dem Diversity am Herzen liegt. Der Konzern hat in den vergangenen Jahren mehr als eine Viertelmilliarde Dollar für entsprechende Initiativen ausgegeben und streckt seine Fühler gezielt nach bislang unterrepräsentierten Gruppen aus. Er schloss zum Beispiel kürzlich eine Allianz mit einer traditionell auf Afroamerikaner ausgerichteten Universität in Washington, die eine Zweigstelle in seiner Zentrale im Silicon Valley eröffnet hat. Allzu große Fortschritte hat Google aber bislang nicht gemacht. Die Anteile von Frauen und Nicht-Weißen haben sich in den vergangenen Jahren nicht allzu sehr verändert. Nach einer Studie der staatlichen Gleichstellungsbehörde EEOC liegen diese Werte in der ganzen Technologieindustrie weit unter dem Durchschnitt aller Branchen.
Diversity-Management hat sich längst auch in Deutschland etabliert. Dazu trug die schon rund zehn Jahre dauernde Erholung am Arbeitsmarkt bei. Konnten sich Personalchefs zuvor noch ihre Wunschkandidaten aus Stapeln von Bewerbermappen herauspicken, stellt sich die Situation heute komplett anders dar: Häufig müssen Unternehmen froh sein, wenn sie offene Stellen mit einem anspruchsvolleren Profil überhaupt noch adäquat besetzt bekommen. Deshalb müssen nun auch Arbeitsmarktpotentiale erschlossen werden, die früher nicht im Mittelpunkt standen. Hinzu kamen gesetzliche Flankierungen wie das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, kurz AGG, das die Diskriminierung am Arbeitsplatz verbietet, oder die 2015 eingeführte Frauenquote für Aufsichtsräte großer Unternehmen.
All das hat die Kultur in den Unternehmen nachhaltig verändert: Kaum eine Broschüre, in der die Testimonials heute nicht streng nach den Vorgaben der Vielfalt ausgewählt werden: Männer und Frauen wechseln sich ebenso ab wie Hautfarben, auf eine junge Person folgt eine ältere. Die Pressesprecherin eines namhaften Konzerns berichtet, dass sie sich für die Besetzung des Podiums einer internen Diskussionsrunde gegenüber der Diversity-Managerin rechtfertigen musste. „Warum war denn da keine Frau auf der Bühne?“ – die Frage klang wie eine Anklage. Dass die Personen mit dem vermeintlich größten Fachwissen zum Thema allesamt Männer waren, spielte keine Rolle mehr. Hauptsache, Vielfalt! Eine männliche Führungskraft räumt wiederum ein, sich mit der Diversity-Managerin im Unternehmen, die gleichzeitig auch Gleichstellungsbeauftragte ist, lieber nicht anlegen zu wollen. „Wenn die in den Raum kommt, sage ich lieber nichts mehr.“ Zu heikel für die eigene Karriere. Deshalb will sich auch kaum jemand zu seiner Kritik bekennen.
Wird das Diversity-Management in deutschen Unternehmen zunehmend zum Selbstzweck? Werden Debatten wie bei Google auch hierzulande kommen? „Nein, die Gefahr sehe ich aktuell nicht“, sagt Katharina Heuer, die der Geschäftsführung der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) vorsitzt. Mit Blick auf Frauen in Führungspositionen sehe sie vielmehr noch Nachholbedarf. Auch Elke Eller kann weder solche Tendenzen erkennen, noch sind ihr aus Deutschland ähnliche Fälle bekannt wie der von Damore. Als Personalvorstand des Reisekonzerns TUI und Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager (BPM) sieht sie Diversity als natürlichen Teil des kulturellen Wandels von Unternehmen. Zur Frage, wie viele Diversity-Manager es in Deutschland überhaupt gibt, liegen beiden Verbänden übrigens keine Daten vor.
Widerspruch kommt ausgerechnet von einem Vorkämpfer für Vielfalt in der deutschen Wirtschaft. Als Personalvorstand paukte Thomas Sattelberger einst die Frauenquote in der Deutschen Telekom durch und macht sich gegen alle Anfeindungen auch für eine allgemeine Quote stark. „Ja, ich sehe solche Zeichen“, sagt Sattelberger mit Blick auf Übertreibungen und führt die Debatten über eine gendergerechte Sprachregelung in Unternehmen an. Er weigere sich bis heute, das große Binnen-I zu benutzen. „Es gibt Grenzen“, findet Sattelberger und glaubt, dass so manchem Fürstreiter der Vielfalt heute der realitätsnahe Blick abgehe.
Sattelberger, der für die FDP in den Bundestagswahlkampf zieht, spricht auch von einem „Klumpenrisiko“, wenn das Diversity-Management vornehmlich in weiblicher Hand ist. Damit verenge sich das Thema häufig auf die Geschlechterfrage. Es gebe sogar eine regelrechte Hierarchisierung der Diversity-Themen: An erster Stelle stünden die Frauen, zuletzt kämen die Behinderten. Auch BPM-Präsidentin Eller plädiert dafür, das Thema Vielfalt „nicht ausschließlich als Initiative für förderungsbedürftige Frauen“ zu verstehen. Sattelberger appelliert deshalb an die Verantwortlichen in den Unternehmen, das Thema möglichst breit zu fassen und Überziehungen klar anzusprechen. Dass es „Online-Pranger“ gebe, auf denen gemeldet werden solle, wenn in Gremien zu wenig Frauen säßen, hält er für absurd.
„Wir müssen unterscheiden, ob wir über Managing Diversity reden oder über Diversity-Management“, sagt Manfred Becker. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Halle war einst für die Personalentwicklung des Autoherstellers Opel verantwortlich und berät heute Unternehmen. Vielfalt sei eben kein Selbstzweck, sagt Becker, sondern für Betriebswirte ein Werkzeug, um letzten Endes das Ergebnis zu verbessern. Diesen Aspekt betont auch DGFP-Geschäftsführerin Heuer. Durch zahlreiche Studien sei nachgewiesen, dass mit „diversen Teams“ eine höhere Produktivität und Problemlösungskompetenz einhergehe. „Sie sind somit ein ganz konkreter Erfolgsfaktor für Unternehmen.“ Es gibt tatsächlich viele Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass gemischte Teams messbar erfolgreicher arbeiten.
Betriebswirt Becker will diese Aussage so pauschal aber nicht stehenlassen. Für hochspezialisierte Aufgaben treffe diese Behauptung nicht zu. „Wenn Sie in der Metallfertigung einen hochstandardisierten Prozess haben, bringt Ihnen ein gemischtes Team wenig.“ Stattdessen sei eine Mannschaft aus gleichen Spezialisten gefragt. Das gelte auch für andere Bereiche mit hohem Expertenwissen. Google und die Programmierer lassen grüßen.
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de