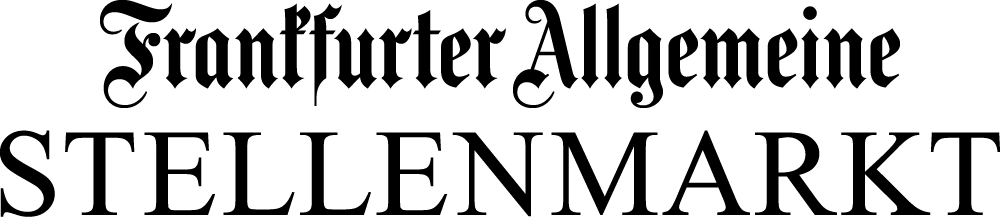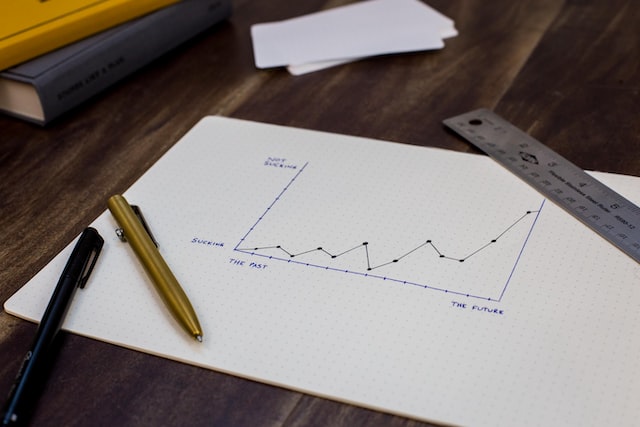Was Stallgeruch und Statussymbole in den Vorstandsetagen bedeuten

Die Biographien vieler Dax-Vorstände folgen einem ähnlichen Muster. Doch die Gremien wandeln sich. Dort sitzen weniger Juristen und mehr Frauen. „Eigengewächse“ haben weiter gute Chancen.
Es gibt ihn, den typischen Dax-Vorstand. Wenn man seinen Aufstieg ganz grob skizziert, dann sieht der etwa so aus: Er hat zunächst Wirtschaft studiert, war einige Zeit im Ausland, hat mit Ehrgeiz stetig Karriere gemacht, die Branche nie gewechselt, allenfalls das Unternehmen, aber auch das nicht zu oft, denn bevor er im Alter von knapp 48 Jahren in den Vorstand berufen wurde, hat er im Schnitt schon 12 Jahre im Unternehmen gearbeitet und sich dabei den nötigen Stallgeruch erworben. Jetzt ist er 53 und verdient im Schnitt rund 3,3 Millionen Euro im Jahr.
Dieses Bild zeichnet eine Dax-Vorstands-Studie der Personalberatung Odgers Berndtson, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt. Sie wirft einen genaueren Blick auf die Lebensläufe der 198 Vorstände, von denen mittlerweile 20 Frauen sind. „Die Aufstiegswege in die wichtigsten deutschen Vorstandsetagen haben sich im vergangenen Jahrzehnt nicht grundlegend verändert“, sagt der Headhunter Klaus Hansen von Odgers Berndtson. Die Studie zeigt dennoch, wie sich die Gremien langsam wandeln. Unaufhaltsam bröckelt die einstige Männerbastion: Der Frauenanteil in den Dax-Vorständen ist von rund einem Prozent 2005 auf knapp 11 Prozent 2016 gestiegen. Das ist zwar nicht ganz so stark wie in den Aufsichtsratsgremien, dort hat der Gesetzgeber aber mit einer gesetzlichen Mindestquote von 30 Prozent nachgeholfen. Quoten in den Vorstandsgremien haben die Unternehmen bislang abwehren können.
Der Druck, mehr Frauen ins Top-Management zu holen, wird aber anhalten. Noch immer haben 13 der 30 Dax-Unternehmen keine Frau im Vorstand, etwa Adidas, Bayer, Volkswagen oder die Deutsche Bank. Im M-Dax sieht es noch düsterer aus: Von 50 Unternehmen haben 43 keine Frau im Vorstand, wie kürzlich eine Auswertung der Personalberatung Korn Ferry ergab. Immerhin hat es dort mit RTL-Chefin Anke Schäferkordt eine Frau auf einen Chefposten geschafft. Das ist im Dax noch keiner gelungen.
Doch das ist nur eine Frage der Zeit. Frauen rücken in der Ressorthierarchie weiter auf. Und die ist laut Personalberatern grob dreigeteilt: ganz oben der Chef, darunter der Finanzvorstand und die Vorstände, die für das operative Geschäft zuständig sind. Erst dann folgen an dritter Stelle die Vorstände für Recht und Compliance, Personal und Einkauf. „Recht & Compliance sowie Personal sind in der Regel immer noch typische Frauenressorts“, sagt Personalberater Hansen. Aber neben sieben Frauen, die als Personalvorstand arbeiten, haben inzwischen neun auch operative Verantwortung. Sie sind für eine bestimmte Region oder ein Geschäftsfeld zuständig, haben also Posten, die in der internen Hierarchie ein höheres Ansehen genießen. Zwei Frauen haben es in diesem Jahr an die Spitze eines Finanzressorts gebracht: Hauke Stars bei der Deutschen Börse und Melanie Kreis bei der Deutschen Post. Die beiden sind nicht die Ersten, vor ihnen hatte diesen Posten schon Simone Menne (heute: Boehringer Ingelheim) bei der Deutschen Lufthansa inne. Allerdings sind die Zeiten, in denen der Finanzvorstand als der geborene „Kronprinz“ im Unternehmen galt, vorbei. Nur jeder siebte Dax-Chef war laut der Studie vor seiner Berufung auf den Thron Leiter des Finanzressorts. Ende der achtziger Jahre war es noch jeder zweite. Heute ist vor allem wichtig, dass er oder sie zuvor bewiesen hat, eine Tochter- oder Landesgesellschaft erfolgreich zu führen. Das gelingt den Frauen immer öfter.
Auch andere Dinge wandeln sich: Früher saßen viele Spitzenmanager nebenbei noch in etlichen Aufsichtsräten, heute lassen sich darauf immer weniger ein. Die Zahl der Mandate hat sich deutlich reduziert. Im Schnitt haben Vorstände heute noch rund zwei Aufsichtsratsmandate, um die sie sich nebenher kümmern müssen. Nach Skandalen und der Finanzkrise hat die Politik die Gesetze verschärft. „Die Aufsichtsräte müssen strenger haften“, sagt Helmuth Uder, Vergütungsexperte bei der Unternehmensberatung Willis Towers Watson. Auch die Gremien träfen sich häufiger – kurz: Für einzelne Mandate muss mehr Zeit aufgewendet werden. Die Ämterhäufung ist daher ein Relikt alter Tage, weil sie kaum zu stemmen ist, wenn die Arbeit als Kontrolleur ernst genommen wird. Der Multi-Aufsichtsrat hat an Glanz verloren.
So geht es auch einem anderen Statussymbol: dem Doktorhut. Noch 2005 hatte mehr als die Hälfte aller Dax-Vorstände promoviert; heute tragen nur noch rund 36 Prozent einen Doktortitel. Das mag mit dem Ansehensverlust des Titels in der Gesellschaft zu tun haben, der durch etliche Plagiatsaffären noch befeuert wurde. Allerdings ist der Doktorhut hierzulande bis heute wichtiger als anderswo: „In Deutschland ist der Doktortitel immer noch ein Gütesiegel“, sagt Hansen: „Außerhalb von Deutschland und Österreich interessiert das aber niemanden.“ Verbreitet und angesehen sei die Promotion in Vorständen vor allem unter Natur- und Ingenieurswissenschaftlern, in anderen Fächern werde sie teilweise durch den praxisorientierten MBA aus der angelsächsischen Welt ersetzt. Dort sei die Promotion zwar in der Wissenschaft wichtig, aber kein Statussymbol für Manager. „Kein Amerikaner führt die englische Bezeichnung ,Ph. D.‘ auf seiner Visitenkarte“, sagt Hansen, „zumal die wenigsten Manager einen haben.“
Wenn alte Statussymbole verschwinden, werden sie durch neue ersetzt. Das Bedürfnis, sich von anderen abzuheben, ist nicht abhandengekommen. Es kommt nur in anderem Gewand daher, gerne etwas subtiler. „Heute ist es ein Statussymbol, einen ,großen Deal‘ eingefädelt zu haben“, sagt Hansen, zum Beispiel eine Übernahme. Das sei aber gefährlich. Für Manager sei die Versuchung groß, so leichtsinnig zum großen Sprung ansetzen zu wollen. Tatsächlich scheiterten rund die Hälfte der Übernahmen – nicht zuletzt an den Egos des Spitzenmanagements.
Meist aber geht es sehr rational zu in den Vorstandsetagen. Die Hälfte aller Spitzenmanager hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Allem Gerede vom jähen Abstieg der Ökonomen zum Trotz haben auch nach der Finanzkrise vor allem sie das Sagen in den deutschen Chefetagen. Alle wichtigen Entscheidungen müssten heute mit Zahlen unterfüttert werden, sagt Hansen, Ökonomen täten sich da leichter gegenüber Analysten und Medien. Das war nicht immer so: Früher hatten in den Vorständen vor allem Juristen dominiert, deren Bedeutung schwindet. Nur noch rund 12 Prozent aller Vorstände haben ein Jurastudium hinter sich.
Öfter als Rechtswissenschaftler schaffen es noch Ingenieure in die obersten Leitungsgremien. In der Autoindustrie sind sie im Spitzenmanagement gesucht, vor allem aber im Maschinenbau, wie eine Studie der Personalberatung Heidrick & Struggles zeigt. Dort dominieren Ingenieure auch heute vor Ökonomen und sind auch noch häufiger promoviert als anderswo. Immerhin liegen die Juristen insgesamt noch vor den Naturwissenschaftlern und Informatikern. Deren Fachkenntnis ist zwar in Unternehmen wegen der Digitalisierung stark gefragt, sie schaffen aber nur in Ausnahmefällen den Sprung ganz nach oben. Von ihnen werde oft sehr tiefes Fachwissen verlangt, sagt Hansen, für allgemeine Führungsaufgaben seien sie aber wegen ihrer starken Spezialisierung weniger geeignet.
Immer exotischer werden auch Vorstände, die überhaupt nicht studiert haben. Gab es vor elf Jahren noch 14 Vorstände ohne akademischen Abschluss, sind es heute nur noch fünf. Der jüngste darunter ist Jan-Dirk Auris, Jahrgang 1968, der sich beim Waschmittelhersteller Henkel vom Lehrling über den Vertrieb in den Vorstand hochgearbeitet hat. Der Fall zeigt auch, dass scheinbar altmodische Eigenschaften wie „Stallgeruch“ im deutschen Management wichtig bleiben. Zwar hatte die Bedeutung der Branchenkenntnis eine Zeitlang abgenommen, seit einigen Jahren nimmt die Quote der „Eigengewächse“ wieder zu. Auf den Chefsessel wird laut der Studie meist ein Kandidat aus dem eigenen Haus berufen. 70 Prozent aller amtierenden Dax-Chefs haben den Großteil ihrer Karriere im eigenen Unternehmen gemacht. Und wenn sie aus einem anderen Unternehmen kommen, dann fast immer von einem Konkurrenten. Branchenwechsel, wie die Berufung von Kasper Rorsted vom Waschmittelhersteller Henkel an die Spitze von Adidas, sorgen für große Schlagzeilen, sind aber die Ausnahme. Viel typischer sind noch immer Karrieren wie die von Daimler-Chef Dieter Zetsche und Siemens-Chef Joe Kaeser, die ihr gesamtes Berufsleben in ihrem Konzern verbracht haben.
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de