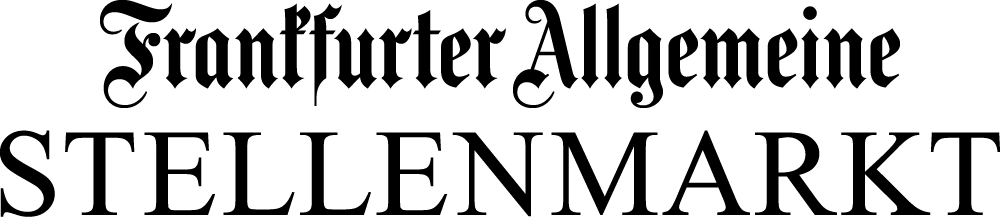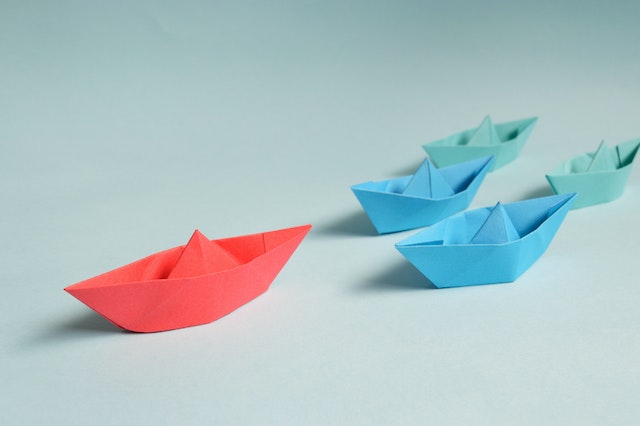Frauen im Beruf: Es kann nur Eine geben

Von Maja Brankovic
Männer halten zusammen, Frauen stehen einander im Weg. Stimmt das? Frauen haben es im Beruf schwerer als Männer. Diese These sorgt nicht nur für Gesprächsstoff, sie ist auch immer wieder ein brisantes Thema in der Politik. Was für die einen wie ein längst überholtes Klischee klingt, ist in den Augen anderer noch heute eine unumstößliche und nur schwer erträgliche Wahrheit. So tief der Graben zwischen den Lagern auch sein mag – die bloßen Zahlen stehen für sich. Tatsache ist: Vor allem in Führungspositionen sind Frauen noch heute deutlich unterrepräsentiert. 2015 waren 40 von 681 Vorständen aller im Dax notierten Unternehmen weiblich. Das sind gerade einmal sechs Prozent.
Die englische Sprache kennt einen knackigen Ausdruck für dieses Phänomen: „gender gap“. Für die „Geschlechterkluft“ – so die etwas sperrige deutsche Übersetzung des Begriffs – gibt es viele mögliche Ursachen; manche von ihnen werden kontrovers diskutiert. Unumstritten ist, dass Frauen mehr Zeit in die Familie investieren als Männer. Nach der Geburt eines Kindes nehmen Mütter eine längere Auszeit und arbeiten auch anschließend im Schnitt weniger Stunden als die Väter. Annahmen über andere vermeintliche Karrierehürden sind deutlich schwerer zu erhärten: Vom fehlenden Willen der Frauen zur Macht ist die Rede. Oder von einer systematischen Diskriminierung. Diese soll nicht nur von Männern ausgehen.
Anstatt einander zu helfen, stehen Frauen einander eher im Weg – dieses Klischee hält sich hartnäckig. Schon im Vorschulalter wird den Mädchen nachgesagt, dass sie untereinander zu Stutenbissigkeit neigen. Unter Jungs, das geben Männer wie Frauen immer wieder an, sei ein solches Verhalten weitaus seltener zu beobachten. Und im Erwachsenenalter? Da zeige sich das unkollegiale Verhalten unter Frauen vor allem im Beruf. Während Männer ihr Netzwerk pflegten und sich immer wieder gegenseitig unterstützten, könnten Frauen auf die Unterstützung der anderen Frauen lange warten.
Auch die Stutenbissigkeit in der Berufswelt hat im Englischen einen klingenden Namen: „queen bee syndrome“, zu deutsch Bienenköniginnen-Syndrom. Der Begriff geht zurück auf eine vielbeachtete Studie, die 1974 im Fachblatt „Psychology Today“ erschien. In einer umfangreichen Erhebung untersuchten Wissenschaftler der Universität Michigan die Beförderungsstrukturen in amerikanischen Unternehmen. Sie fanden heraus, dass Frauen, die sich in einer „Männerwelt“ beruflich etablieren konnten, eher dazu neigten, den Aufstieg anderer Frauen zu missbilligen oder gar zu behindern. Ihre Beobachtung führten die Wissenschaftler auf den unbedingten Willen erfolgreicher Frauen zurück, ihre Position zu behaupten. „Die echte Bienenkönigin hat sich in der Männerwelt beruflich durchgesetzt und dabei mit links ihren Haushalt und ihre Familie geführt.“ Wenn sie es ohne Unterstützung nach oben geschafft hat – müssten das die anderen dann nicht auch können?
Sicher lässt sich argumentieren, dass sich das Arbeitsumfeld seit den siebziger Jahren stark verändert hat – und damit auch der Blick der erfolgreichen Frauen auf ihre weibliche Konkurrenz. Doch auch heute sind die Vorbehalte noch längst nicht verflogen. Im Jahr 2013 veröffentlichte die Zeitschrift „Nature“ eine Sonderausgabe zum Thema Frauen in der Wissenschaft. Furios war das Geständnis, mit dem eine weibliche Autorin ihren Beitrag begann: „Ich habe ein Vorurteil gegen Frauen in der Wissenschaft“, schreibt Jennifer Raymond, die als Neurobiologin an der Universität Stanford forscht und lehrt. „Bitte nehmt es mir nicht übel.“
Mit ihrer Haltung ist Raymond sicher nicht allein. Doch ist sie auch repräsentativ für andere Frauen, die es in ihrem Beruf weit gebracht haben? Entgegen allen Vorurteilen deutet eine Reihe von Studien darauf hin, dass sich Frauen gegenseitig durchaus unterstützen. In einer gerade veröffentlichten Studie haben italienische und amerikanische Ökonomen die Lohnstruktur in rund tausend Industrieunternehmen in Italien untersucht. Das Ergebnis: Unter weiblichen Chefs können Frauen mehr Geld verdienen als unter Männern. Zwar bekamen Frauen, die sich am unteren Ende der unternehmensinternen Lohnskala befinden, unter einer weiblichen Geschäftsführung rund 3 Prozent weniger Gehalt. Jene Frauen aber, die die Karriereleiter schon weiter erklommen hatten, wurden von Frauen deutlich besser entlohnt. Für die obersten 25 Prozent bedeutete eine Chefin im Schnitt rund 10 Prozent mehr Gehalt.
Auch auf der Karriereleiter scheinen sich Frauen gegenseitig nicht unbedingt im Wege zu stehen. Die Ökonominnen Astrid Kunze und Amalia Miller haben am Beispiel Norwegen gezeigt, dass ein höherer Anteil an weiblichen Führungskräften den beruflichen Aufstieg anderer Frauen begünstigt. In ihrer Studie aus dem Jahr 2014 werteten die Forscherinnen Daten von mehr als 4000 norwegischen Unternehmen über einen Zeitraum von elf Jahren aus. Dabei fanden sie heraus, dass vor allem Frauen auf den untersten Ebenen öfter befördert werden, wenn der Frauenanteil auf der Führungsebene höher ist. Kunze und Miller erklären ihre Beobachtung damit, dass eine weibliche Führungskraft eher die Funktion eines Vorbildes oder einer Mentorin übernimmt als ihr männlicher Kollege. „Ein Grund für den langsamen Aufstieg von Frauen an die Spitze der Unternehmenshierarchie ist die historische Dominanz der Männer in den Führungspositionen“, schlussfolgern die Ökonominnen.
Eine Chefin solidarisiert sich mit ihren weiblichen Angestellten, von Stutenbissigkeit also keine Spur? Ganz so einfach ist das nicht. Denn die Studie zeigt auch, dass sich ein über alle Hierarchiestufen insgesamt hoher Anteil an weiblichen Beschäftigten eher negativ auf die Aufstiegschancen der einzelnen Mitarbeiterinnen auswirkt. Der Mechanismus ist einfach: Je mehr Frauen in einem Unternehmen arbeiten, desto mehr kommen überhaupt für eine Beförderung in Frage. Oder anders formuliert: Die Konkurrenz zwischen den Arbeiterinnen um die Gunst der Bienenkönigin wächst. Mit dem Mythos der Stutenbissigkeit können die norwegischen Forscherinnen also nicht ganz und gar brechen, das geben sie sogar selbst in ihrem Aufsatz zu: „Unsere Ergebnisse verkomplizieren die Geschichte, dass sich Frauen gegenseitig helfen.“ Dass sich Männer auf derselben Ebene auch nicht unter allen Umständen den Rücken freihalten? Geschenkt.
G. Staines, C. Tavris, T. E. Jayaratne: The queen bee syndrome. Psychology Today, 7(8), 55-60. 1974.
L. Flabbi, M. Macis, A. Moro, F. Schivardi: Do Female Executives Make a Difference? The Impact of Female Leadership on Gender Gaps and Firm Performance, NBER Working Paper 22877, Dezember 2016.
A. Kunze, A. R. Miller, Women helping women? Evidence from Private Sector Data on Workplace Hierarchies, NBER Working Paper 20761, Dezember 2014.
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de