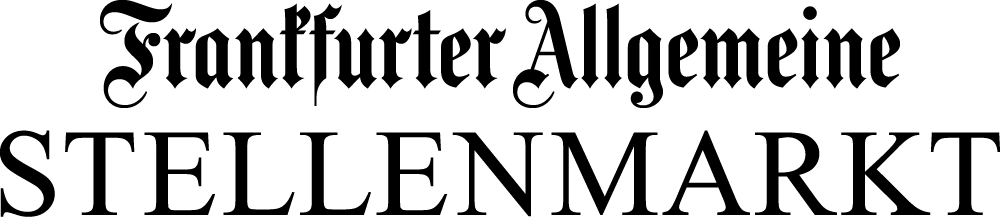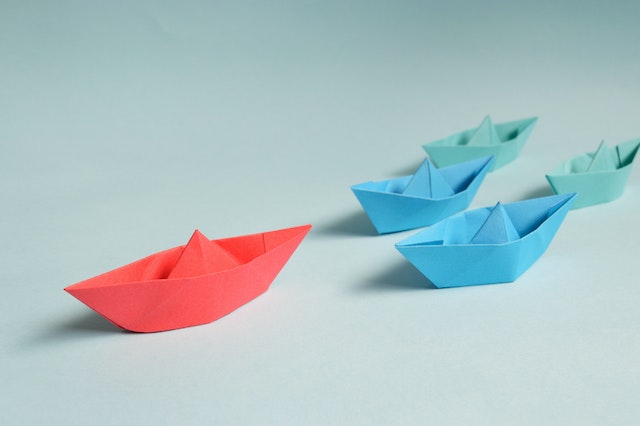Scheiterkultur: Hinfallen, aufstehen, weitermachen

Amerikaner geben niemals auf, wenn sie ein Ziel erreichen wollen. Mit Verlierern will keiner etwas zu tun haben.
Von Roland Lindner
Travis Kalanick stand nicht immer ganz oben. Der Fahrdienst Uber, den er mitgegründet hat und als Vorstandsvorsitzender führt, ist heute das am höchsten bewertete Start-up-Unternehmen der Welt. Aber seine Karriere begann mit einem Reinfall, denn sein erstes Unternehmen musste Insolvenz anmelden. Damit ist Kalanick in bester Gesellschaft. Einige der berühmtesten und erfolgreichsten amerikanischen Unternehmer haben in ihren frühen Jahren Bekanntschaft mit dem Insolvenzrichter gemacht, vom Autopionier Henry Ford über den Medienmogul Walt Disney bis zum Ketchupproduzenten Henry J. Heinz. Präsidentschaftsanwärter Donald Trump hat in seinem Firmenimperium eine Reihe von Pleiten erlebt.
Hinfallen und wieder aufstehen, das gehört zum amerikanischen Mythos. „Dust Yourself Off and Try Again“, heißt es in den Vereinigten Staaten oft, also: Dreck abwischen und es wieder versuchen. Dahinter steckt der Optimismus, etwas schaffen zu können, wenn man nur nicht aufgibt – die legendäre „Can do“-Mentalität im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Hier wurde schließlich Elvis Presley zum Superstar, der sich anfangs seiner Karriere noch anhören musste, er werde es als Sänger nie zu etwas bringen und solle lieber zu seinem alten Job als Lastwagenfahrer zurückkehren. Und Fred Astaire bekam einmal bescheinigt, er könne weder singen noch schauspielern und höchstens ein bisschen tanzen, bevor er zur Hollywood-Legende wurde.
Scheitern wird in Amerika oft nur als eine Zwischenstation auf dem Weg zu großen Taten gesehen, ja vielleicht sogar als willkommene Vorstufe, die wertvolle Lektionen für den späteren Erfolg bereithält. Diese Einstellung ist zum Beispiel in der kalifornischen Technologieregion Silicon Valley weit verbreitet, die sich als Ort für Draufgängertum und Risikofreude versteht. Klappt es hier mit einer Idee nicht, versucht man eben etwas anderes und muss nicht unbedingt fürchten, von Investoren gemieden zu werden.
Und doch ist Scheitern auch in den Vereinigten Staaten keineswegs generell akzeptiert und frei von Stigma. „Scheitern ist erst im Nachhinein okay, wenn man Erfolg hat“, sagt zum Beispiel die 34 Jahre alte Patrice Washington, die heute als selbständige Finanzberaterin gut verdient, aber auf schwierige Zeiten zurückblickt. Sie hatte ein Immobilienunternehmen in Kalifornien, das im Zuge der Finanzkrise des vergangenen Jahrzehnts zusammenbrach und sie am Ende mit zwei Millionen Dollar Schulden dastehen ließ. „Mir haben damals einige Leute das Gefühl gegeben, dass sie mich verurteilen oder sogar verspotten.“
Washington war mehrmals in ihrem Leben in Finanznöten. Mit 22 Jahren hatte sie 18 000 Dollar Kreditkartenschulden angehäuft, nicht einmal wegen extravaganter Einkäufe, sondern weil sie unterschätzt hatte, wie schnell sich Zinsen summieren können. Sie schwor sich, dass ihr das nie wieder passieren würde und begann, strikt mit ihrem Geld zu haushalten, bis sie schuldenfrei war. 2003 gründete sie zusammen mit ihrem heutigen Mann die Immobilienfirma. Zu der Zeit ließ sich im Häusermarkt viel Geld verdienen, und die Firma wuchs auf mehr als ein Dutzend Mitarbeiter an. 2007 kühlte sich das Geschäft aber ab, und die bald folgende Finanz- und Wirtschaftskrise brachte es fast ganz zum Erliegen. Zu allem Unglück musste Washington inmitten dieser Turbulenzen wegen Komplikationen in ihrer damaligen Schwangerschaft für mehrere Wochen ins Krankenhaus, und als sie schließlich mit ihrer neugeborenen Tochter nach Hause gehen konnte, wurden ihr 400 000 Dollar in Rechnung gestellt, weil ihre Versicherung nur zum Teil für die Behandlung aufkommen wollte. Washington und ihr Mann waren erst entschlossen, sich mit ihrer Firma in der Krisenzeit weiter durchzuschlagen, mussten aber am Ende doch kapitulieren. Sie versuchten dann, den resultierenden Schuldenberg abzubauen, sahen aber nach ein paar Jahren keinen anderen Ausweg, als Privatinsolvenz anzumelden.
Heute gibt Washington in Büchern und bei Fernsehauftritten Finanztipps. Sie sagt, zusammen mit ihrem Mann komme sie wieder auf ein siebenstelliges Jahreseinkommen. Aber der Kollaps ihrer vorherigen Firma wirkt nach, und sie erinnert sich, dass der Neustart nicht leicht war. Viel sei damals hinter ihrem Rücken getuschelt worden, und sie habe sogar Schadenfreude gespürt, selbst aus ihrer eigenen Familie. Es seien hämische Dinge gesagt worden wie: „Du bist wohl doch keine so große Nummer.“ In sozialen Netzwerken wird ihr noch heute manchmal vorgeworfen, sie habe sich mit der Insolvenz aus der Verantwortung für ihre Schulden gestohlen. Ein schlechtes Gewissen hat sie deswegen nicht. „Die Banken sind von der Regierung gerettet worden, aber sie haben selbst den Leuten nicht geholfen. Wir haben lange versucht, eine andere Lösung mit den Banken zu finden.“
Susan Davis-Ali, die eine Karriereberatung für Frauen mit dem Namen „Leadhership 1“ betreibt, hat beobachtet, dass Amerikaner Scheitern weniger akzeptieren, als sie das selbst von sich behaupten. Die Toleranz von Misserfolgen sei hier zwar höher als anderswo, aber es gebe keinen allgemeinen Freibrief. Unternehmern werde Scheitern eher verziehen als Angestellten, und gerade in besonders innovationsgetriebenen Segmenten wie der Technologieindustrie führe kein Weg daran vorbei, Fehlschläge als Teil der Arbeit zu begreifen. „Da gehört es zum Bewusstsein, oft viele Anläufe zu brauchen, bis man einen Treffer landet.“ Unternehmen im Silicon Valley sind berühmt für Leitsätze wie „Move Fast and Break Things“ („Beweg dich schnell, und mach Dinge kaputt“), die den Mitarbeitern signalisieren sollen, dass auch einmal etwas in die Hose gehen darf, wenn man ambitionierte Projekte verfolgt.
Ansonsten hängt es nach Meinung von Davis-Ali aber oft vom einzelnen Unternehmen und seiner Kultur ab, inwiefern Versagen und Misserfolg geduldet werden. Und auch davon, welche Konsequenzen mit einem Fehltritt verbunden sind. Wer bei einem Autohersteller einen Defekt zu verantworten hat, der zu Unfällen und Rückrufen führt, werde nur schwerlich Sanktionen entgehen können. General Motors zum Beispiel hat sich im Zuge eines öffentlichkeitswirksamen Rückrufs wegen eines Zündschlossdefekts vor zwei Jahren von einer Reihe von Mitarbeitern getrennt. Nach Meinung der Karriereberaterin bestimmt auch das Ansehen im Unternehmen, ob und inwiefern jemand auf Gnade hoffen darf. Davis-Ali erinnert sich, wie sie einmal eine von ihr ohnehin nicht besonders geschätzte Mitarbeiterin nach einem groben Fehler entließ. „Das hat mir einen guten Grund gegeben, mich von ihr zu trennen. Einer Top-Leistungsträgerin hätte ich es dagegen ohne Zögern verziehen.“
Finanzberaterin Washington blickt auf den Misserfolg ihres vorherigen Unternehmens mit Selbstkritik zurück und begreift ihn auch als persönliches Scheitern, wenngleich das damalige Umfeld denkbar schwierig war. Sie sagt, sie hätte die Warnzeichen früher erkennen müssen und damit vielleicht vermeiden können, immer tiefer in der Verschuldung zu versinken. „Aber ich dachte, ich komme da mit meiner Can-do-Einstellung wieder raus.“ Heute ist sie wieder obenauf und kann sich rehabilitiert fühlen. Solche Comeback-Geschichten lieben die Amerikaner. Aber dieses Comeback musste Washington erst einmal schaffen. Sie hat schmerzhaft gelernt, dass sich die Akzeptanz des Scheiterns auch in Amerika in Grenzen halten kann, wenn man gerade mitten in der Misere steckt. Und selbst Donald Trump demonstriert trotz eigener mehrfacher Ausrutscher wenig Toleranz für Niederlagen. Wenn er mal wieder jemanden beleidigen will, dann tut er das vorzugsweise mit dem Wort „Loser“ – „Verlierer“.
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de